 Die Erfolge der Technik und die Überbewertung der
Die Erfolge der Technik und die Überbewertung der
exakt-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise
Von Max Thürkauf
erschienen in:
Verhandl. Naturf. Ges. Basel, Band 81, Nr. 1, Seiten 1-39, Basel, 31.3.1971
(Manuskript eingegangen am 27. August 1969)
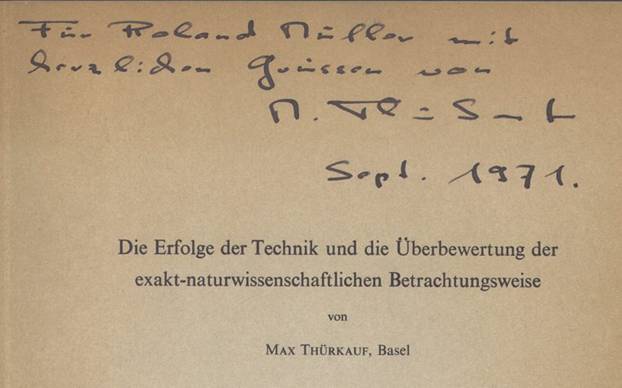
Über den Wert einer Kritik
Allem voran sei in Deutlichkeit und ohne die geringste Rücksicht auf den Autor dieses Vortrages gesagt, eine Kritik ist nie mehr, gewöhnlich aber weniger wert als der Kritiker selbst. Diese Feststellung ist wörtlich zu verstehen. Das heisst, in Hinsicht auf die menschliche Unzulänglichkeit und Hinfälligkeit ist jegliche Kritik als hinfällig und unzulänglich zu betrachten. Dessen wollen wir uns bewusst sein und bleiben.
Ich gestatte mir, dies ganz besonders jenen als Stammbuchnotiz zu empfehlen, die recht haben wollen. Man kann ganz einfach nicht recht haben. Denn recht haben als Verb oder Recht haben als Besitz würde letzte Erkenntnis voraussetzen. Aber es gibt keine letzte Erkenntnis. Auch wenn wir sie noch so gerne haben möchten. Letzte Erkenntnis liegt am Ende eines Weges, der nicht im Diesseits endet. Wir müssen uns bescheiden und erkennen; das einzige Ziel, das wir erreichen können, ist der Weg selbst. Wer offenen Herzens ist und sich ehrlich bemüht, kann diesen Weg finden und beschreiten.
Für alle, die das machen wollen, was man heute eine Karriere nennt, ist das Nadelöhr am Anfang dieses Weges zu eng. Viel zu eng sogar. Auch wer von einem sogenannten Lebenswerk träumt, misst sich ein Ränzlein an, das an Umfang grösser ist als die lichte Weite der engen Pforte. Allzu leicht wird das Leben dem Lebenswerk geopfert. Und zwar in allen Fällen nicht nur das Leben des Lebenswerklers selbst, sondern auch andere Leben und Lebendiges überhaupt.
Ehrgeiz gehört zu den Substanzen eines jeden Menschen. Mit ihm verhält es sich wie mit allen Dingen der Welt. Gut oder schlecht ist immer eine Frage des Masses und der Beziehung. Sowohl zuviel als auch zuwenig ist schlecht. Das Mass an Ehrgeiz ist dann gut, wenn dieser mit seinen Gegenkräften im Gleichgewicht steht. Das heisst, je stärker Demut, Zurückhaltung und Bescheidenheit sind, um so grösser darf der Ehrgeiz sein. Mit andern Worten oder anschaulicher gesagt: nur bescheidene und demütige Menschen können es sich leisten, ehrgeizig zu sein.
Wer in Beziehung auf sich selbst von Karriere oder Lebenswerk spricht, ist niemals bescheiden. Der Ehrgeiz überwiegt und will recht haben. Hinter der Kritik eines solchen Menschen steht keine ehrliche Bemühung. Seine Kritik ist daher nicht wertvoll. Vielmehr ist sie voll von Hintergedanken. Sie ist für ihn Mittel zur Karriere, Mittel zum Lebenswerk, also Mittel zum Zweck. Im Zentrum seiner Kritik steht immer er selbst. Dies ist widerlich und wird auch meist so empfunden. Da auch Karrierebesessene selten ganz ohne Einsicht sind, zeigen sie ihr Gesicht nur in Ausnahmefällen unverhüllt. Eine solche Enthüllung leisten sie sich gewöhnlich erst in einem Alter, wo die Karriere als gesichert erscheint. Sie sonnen sich im Erfolg. Wer kennt sie nicht, diese Päpste der Wissenschaft und Philosophie. Ihre Kritik ist nur dann ehrlich und offen, wenn Ehrlichkeit und Offenheit den Erfolg nicht gefährden. Was ist Erfolg? Zustimmung der Gesellschaft, Anerkennung von aussen her. Ehrliche Bemühung aber kommt immer von innen. Wer sich ehrlich bemüht, kümmert sich nicht um den Erfolg.
Wie kann verborgenes Karrieredenken und getarnter Wille zum Lebenswerk erkannt werden? Sehr einfach! Jeder, der recht haben will, ist dieser egozentrischen Zielsetzung verdächtig. Der Wert der Kritik eines Rechthabers ist unbedingt in Zweifel zu ziehen, da mit grosser Sicherheit angenommen werden kann, dass sie als Mittel zum Zweck und nicht als Bemühung um Erkenntnis ausgesprochen wird. An was erkennt man Rechthaber? Auch das ist sehr einfach! Rechthaber können nicht zuhören und können einen andern nicht reden, vor allen Dingen nicht ausreden lassen. Da Rechthaber nicht zuhören können, wissen sie nicht, von was der andere gesprochen hat beziehungsweise sprechen wollte. Es entsteht daher nicht selten die ergötzliche Situation, dass er nach gelungener Unterbrechung des andern von etwas zu sprechen anfängt, das mit dem Thema in keinerlei Zusammenhang steht. Das spielt für ihn allerdings keine Rolle, denn er will ja nicht an einem Gespräch teilhaben, sondern in seiner Sache recht haben. Eben in der Sache, mit der er Karriere machen will. Seiner Kritik mangelt die ehrliche Bemühung; ihr Wert ist dergestalt, dass ohne Verlust darauf verzichtet werden kann.
Der Vollständigkeit halber soll noch eine weitere Methode genannt werden, mit der sich Rechthaber durchzusetzen versuchen. Da es uns ein Anliegen ist, den Wert einer Kritik zu erkennen, müssen wir in der Lage sein, die Zeichen der Selbstsucht klar zu sehen. Hat der Rechthaber einmal das Wort ergriffen, so versucht er es mit allen Mitteln zu behalten. Das zwingt ihn zu langen, ineinandergeschachtelten Sätzen. Etwas einfach und klar zu sagen, ist ihm geradezu ein Schrecken. Denn das würde seinen Willen zur Karriere offenbaren und ihn am langen Sprechen hindern. Worte reihen sich an Worte. Ein Ende ist nicht abzusehen. Natürlich wird er behaupten, seine Gedanken seien dermassen tief und kompliziert, dass sie mit klaren und kurzen Sätzen nicht dargestellt werden können. Nun, darüber viel Worte zu verlieren, lohnt sich nicht. Klare Gedanken können immer klar dargestellt werden. Auch komplizierten Dingen ist eine klare Darstellung nicht verschlossen. Dies gilt ohne Ausnahme. An diese Tatsache sollte besonders bei wissenschaftlichen und philosophischen Betrachtungen gedacht werden. Aber eben, allzu bekannt sind jene Wissenschaftler und Philosophen, die sich in möglichst komplizierten und kaum verstehbaren Form ulierungen bewundert sehen wollen. Von solchen Machenschaften wollen wir in aller Entschiedenheit Abstand nehmen. Es soll eindeutig festgehalten sein: Alles, was Menschen zu denken vermögen, kann mit Hilfe der Sprache klar dargestellt und mitgeteilt werden.
Die unglücklichen Folgen des Rechthabens, der Karriere und des sogenannten Lebenswerkes wollen wir uns immer vor Augen halten. Mit unserer Kritik wollen wir unter keinen Umständen recht haben. Es soll eine Kritik der ehrlichen Bemühung, der Demut und der Bescheidenheit sein.
Noch etwas gibt es, das zu äusserster Vorsicht und Zurückhaltung mahnen muss. Die Schulen. Nicht die Dorfschulen, Mittelschulen oder auch Hochschulen. Gemeint sind die sogenannten Schulen. Das nämlich, was eine « Schule Huber» oder « Schule Müller» genannt wird. Kritik, die aus einer solchen Schule kommt, ist nie frei von Karriere und Lebenswerk. Immer hat die Meinung des Lehrers in Erscheinung zu treten. Und gar nicht selten an erster Stelle. Dabei braucht die Meinung des Lehrers nicht einmal eine eigene zu sein. Im Hintergrund, gewissermassen als Bezugspunkt und Rechtfertigung, können ohne weiteres - um willkürlich einige Namen zu nennen - Herren wie KANT, BOLTZMANN, HEGEL, NEWTON, GOETHE oder STEINER stehen. Wehe dem, der es wagt, an der Richtigkeit oder gar Wahrheit solcher Schulen und ihrer Systeme zu zweifeln. Ehrliches Bemühen ist da nicht gefragt. Vielmehr geht es darum, die Schule mit allen Mitteln zu bestätigen. Zugehört wird nur dann, wenn die Rede im Sinne der Schule ist. Kritik ist immer Mittel zum Zweck, Mittel zur Behauptung der Schule. Solche Kritik kann nicht die unsere sein. Denn niemals wollen wir recht haben. Vielmehr soll uns die ehrliche Bemühung wegweisend sein. Es ist somit ausgeschlossen, dass aus unseren Betrachtungen eine sogenannte Schule entsteht. Dass dies nicht zeitgemäss ist, bin ich mir bewusst. Doch kümmert mich das nicht. Denn unsere Kritik soll für das Leben gegen den Zwang von Systemen und Maschinen sein. Das Leben und alles Lebendige ist nie zeitgemäss. Daher hat es immer unter dem zu leiden, was als zeitgemäss betrachtet wird.
Wenn in den exakten Naturwissenschaften Schulen regieren, so ist dies weiter nicht schlimm. Denn die exakten Naturwissenschaften stehen in keiner Beziehung zum Leben. Diese fundamentale Tatsache ist keineswegs anerkannt. Vielmehr wird von den Physikern und Chemikern mit allen Mitteln, das heisst mit den Mitteln der Chemie und Physik, versucht, das Leben als eine Summe von physikalisch-chemischen Prozessen darzustellen. Diese Tätigkeit, die enorm modern ist und sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit ausbreitet, soll einer der Hauptgegenstände unserer Kritik sein. Vor allen Dingen die Folgen und Auswirkungen solchen Tuns auf das Leben und das Lebendige wollen wir kritisch betrachten. Ein Vergleich bringt oft mehr Klarheit als eine minuziöse Beschreibung der Sache selbst. Daher wollen wir uns seiner recht oft bedienen. Einer sei hier als Beispiel vorausgegriffen: Die Methoden der exakten Naturwissenschaften tragen in Hinsicht auf das Lebendige keine prinzipiell andern Möglichkeiten in sich als das Skalpell des Anatomen. Diese Beschränkung, die von den Physikern und Chemikern entweder ungerne gesehen ist, nicht gesehen werden will oder ganz einfach nicht gesehen wird, soll ein weiterer Gegenstand unserer Betrachtungen sein.
Eine mittelbare Beziehung zwischen dem Lebendigen und den exakten Naturwissenschaften existiert natürlich. Der menschliche Geist nämlich, in welchem die Wissenschaften ihren Ausdruck finden. Denn im menschlichen Denken und nicht etwa in der Natur selbst existieren die Naturwissenschaften. Das liegt auf der Hand. Doch wird diese Tatsache, wie vieles auf der Hand Liegende, selten beachtet. Wenig Beziehung aber heisst noch lange nicht wenig Einfluss. Die exakten Naturwissenschaften haben über den Weg der Technik und des Geschäftes einen immensen Einfluss auf alles Lebendige. Ein Umstand, der zur Sprache kommen soll.
Eine Besonderheit des Lebendigen besteht darin, dass es nicht mit einem vorgefassten Denksystem in den Griff bekommen werden kann. Das Leben lässt sich nicht mit Systemen erfassen, die exakt festgelegt sein wollen. Eine Kritik für das Leben, gegen die Herrschaft der Maschine muss daher auf einem Denken beruhen, das sich nicht einem vorgefassten System verschrieben hat. Das heisst etwa nicht, dass ein solches Denken inkonsequent ist. Im Gegenteil! Seine Konsequenz besteht in der Gegebenheit des Lebendigen. Das ist mehr, aber auch schwieriger, als die Dinge über den Leist einer Theorie zu schlagen, die genehm oder bequem ist. Ehrliche Bemühung und der Wille, den andern anzuhören, sind erforderlich. Das führt zur Bescheidung und zum Erkennen, dass sehr wohl der Weg beschritten, das Ziel aber nicht erreicht werden kann. Es gibt das Leben und die Leben. Das Leben währt immer; die Leben hingegen müssen werden und vergehen. Das Leben ist das Ziel, und die Leben sind der Weg.
Bedenklicher sind die sogenannten Schulen, wenn diese sich Bereiche anmassen, die in direkter Beziehung zum Leben stehen. Kein Leben ist für uns unmittelbarer als das Menschenleben. Allerdings dürfen wir dabei nie vergessen, dass das Menschenleben mit allem Lebendigen auf das innigste verwoben ist. Es ist dies eine Gegebenheit, die zu den Gegenständen unserer Betrachtungen gehören soll. Die vornehmste Aufgabe der Philosophie ist es, sich darum zu bemühen, das Leben in der Form des menschlichen Seins zu verstehen. In diesem Sinne soll die Philosophie auf dem Weg zur Erkenntnis vorwärts schreiten. Sich wohl bewusst, dass der Weg dort endet, wo das Leben des Suchenden endet, und dass die Erkenntnis immer jenseits steht. Wo diese Einsicht fehlt, erzwingt der Ehrgeiz eine vorgefasste Meinung. Das Rechthaben hält Einzug. Eine Schule wird begründet. Die Philosophie wird Beruf.
Berufsphilosophen sind daher schlechte Berater. Ihre Kritik ist stets auf ein Ziel ausgerichtet: die Bestätigung einer vorgefassten Lehre. Das aber ist für eine Betrachtung des Lebendigen unbrauchbar. Leben ist nicht vorgefasst. Leben ist stets wiederkehrendes Neusein. Alle Lebewesen haben etwas Gemeinsames, aber keines ist wie das andere. Die Mannigfaltigkeit der Leben ist auf das engste mit der Einheit des Lebens verknüpft.
Leben kann nicht erfasst werden. Aber es kann in der Bemühung um Verstehen und Verständnis gelebt werden. Dies fordert eine Philosophie der Ehrlichkeit. Es ist dies die einzig wahre Philosophie. Sie setzt unvoreingenommenes Betrachten und Schauen voraus. Behauptungen werden nie aufgestellt. Die Bereitschaft des Eingestehens steht an einer der ersten Stellen. Vorausgesetzt ist die Bereitschaft des Zuhörens. Zuhören ist schwer. Aber wer guten Willens ist, kann es lernen.
Das einzige, was die philosophischen Schulen mit ihren verschiedenen Richtungen wirklich bewiesen haben, ist, dass keine recht haben kann. Warum? Weil alle recht haben wollen! Da alle zueinander im Widerspruch stehen, ist es aus logischen Gründen klar, dass nur eine der Schulen recht haben kann. Da aber alle mit den trefflichsten Mitteln beweisen, dass sie recht haben, steht uns kein Mittel für eine Entscheidung zur Verfügung.
So sind wir gezwungen, uns von den philosophischen Schulen zu distanzieren. Natürlich kann von der Begründung einer neuen Schule aus den genannten Gründen überhaupt nicht die Rede sein. Wer in dieser Richtung etwas sucht, ist hier am falschen Platz. Es soll hier ganz einfach nichts gegründet werden. Nicht mit einem wohlformulierten Rezept, sondern mit der Erkenntnis, dass wir nichts wissen können, wollen wir für das Leben und gegen die Herrschaft der Maschine und des Geschäftes sein. Ich betone: sein. Sie fragen, warum nicht kämpfen? Jeder Kampf um oder für etwas fordert vorgefasste Ansichten. Just das, was den Wert der philosophischen Schulen in Frage stellt und eine von Bemühung und Demut getragene Kritik verhindert. Sein ist mehr als kämpfen. Es ist schwerer, zu sein als zu kämpfen. Das lehrt die Geschichte. Sie zeigt, dass Sein stärker ist als Krieg. Das Wort ist mächtiger als das Schwert.
Nicht ungesagt soll bleiben, dass es auch Philosophen ohne den Anhang einer Schule gab und gibt. Da sie sich keine Schüler hielten, mussten sie auch nicht recht haben. Ihre Zuhörer kamen freiwillig. Sie fühlten sich auch nicht berufen, philosophische Gesellschaften zu gründen und ihnen vorzustehen. Ein grosser unter ihnen war SOKRATES. Er hat um nichts gekämpft, sondern das Sein gelebt. Er wurde dafür zum Tode verurteilt. Aber SOKRATES' Sein ist geblieben. Er wollte nie recht haben. Er wusste, dass er nichts wusste. Soll ich noch andere Namen nennen? Warum nicht? BLAISE PASCAL, SÖREN KIERKEGAARD, FRIDTJOF NANSEN, ALBERT SCHWEITZER. Lebende möchte ich nicht nennen. Denn solange sie leben, können sie immer noch eine Schule oder eine Gesellschaft gründen.
Natürlich wollen wir uns keinem Philosophen oder Wissenschaftler verschliessen. Im Gegenteil ! Denn eine Kritik der ehrlichen Bemühung setzt Offenheit voraus. Jeder soll angehört werden, und zwar ohne Vorurteil. Das befreit uns keinesfalls von der Bildung eines Urteils. Das Wort Urteil klingt mir unangenehm; lieber möchte ich sagen: Meinung. Es soll nicht mit den Worten geklaubt werden. Doch für uns soll die Sprache ein Mittel zur Verständigung und nicht Informationsübermittler sein. Übrigens: Verständigung macht Information überflüssig. Heute haben wir einen Überfluss an Information und einen Mangel an Verständigung. Täglich nehmen die Informationsmittel zu, die Verständigung aber nimmt ab. Dies ist bedenklich und beängstigend. Was wir brauchen; ist Verständigung und nicht Information.
Das, was wir heute unter Information verstehen, stammt aus den exakten Naturwissenschaften und der Technik. Da weder diese noch jene eine Verwandtschaft zum Leben haben, können mit Informationen die Gegebenheiten des Lebendigen nicht dargestellt werden. Information ist wohl notwendig, aber nicht hinreichend für eine Verständigung. Diese Tatsache wird vor allen Dingen von den Kybernetikern bestritten. Ihrer Meinung nach ist das Verhalten des Lebendigen nichts anderes als eine Koppelung und Rückkoppelung von Informationen. Dies aber entspricht nicht der Natur, sondern dem Wunsch und der Vorstellung der Kybernetiker.
Alles Leben ist in einer untrennbaren Gemeinschaft miteinander verbunden. Eine Gemeinschaft erfordert immer Verständigung und Verständnis. Den Lebewesen ist die Möglichkeit zur Beziehung und Mitteilung gegeben. Die Krone von Beziehung und Mitteilung ist die Sprache des Menschen. Durch sie können Beziehung und Mitteilung zum Verständnis werden.
Informationen können immer in Impulse irgendwelcher Art aufgelöst und als solche übertragen werden. Sprache hingegen ist niemals in Impulse auflösbar. Die Sprache entsteht in der Einheit der Lebewesen und ist selbst eine Einheit, in der sich die Vielfalt des Lebens spiegelt. Zur Sprache gehört nicht nur das gesprochene und das geschriebene Wort. Alles, was sich an einem Menschen bewegen und verändern kann, ist Ausdrucksmittel der Sprache. Oder denken wir an das Auge; keine Information vermag seinen Blick zu fassen. Allein durch die Sprache kann das Vermögen des Blickes zum Ausdruck gebracht werden, weil er ein Teil der Sprache ist. Auch Tiere können blicken. Blumen können blühen. Dies sei in Hinsicht auf die Frage bemerkt, ob Pflanzen und Tiere auch eine Sprache haben.
Wer den Unterschied zwischen Sprache und Information schwarz auf weiss sehen will, der hat es heute einfach. Da für die Darstellung exakt-naturwissenschaftlicher Untersuchungen die Information genügt, werden diese in den allermeisten Fällen als Information und nicht als Sprache niedergeschrieben. Ausser der Hässlichkeit ist daran nichts zu beanstanden, da der dargestellte Stoff keine Beziehung zum Träger der Sprache, zum Lebendigen hat. Das heisst, eine Beziehung besteht: die Person des Wissenschaftlers. So selbstverständlich diese Tatsache ist, so oft wird sie vergessen. Hauptsächlich in Hinsicht auf die Konsequenzen für die exakten Naturwissenschaften selbst. Es ist dies daher ein Thema unserer Kritik. Wird nun eine solche aus Information bestehende Schrift mit Werken von PLATON, TOLSTOI, SCHILLER oder auch NEWTON verglichen, so hat man den Unterschied zwischen Sprache und Information in aller Deutlichkeit vor sich. Etwas äussert sich ganz besonders: Information ohne Sprache ist hässlich. Allerdings, die exakten Naturwissenschaften erheben auf Schönheit auch keinen Anspruch. Dieser Verzicht wird besonders beim Anblick ihrer Tochter, der Technik, offenbar. Ich weiss, es gibt die Schönheit der Technik.
Die Schönheit der Dinge hat eine Bewandtnis. Schönheit ist nämlich nicht unwesentlich, denn wir können uns daran freuen. Allerdings ist es nicht unbedingt einfach, Schönheit zu erkennen. Somit kann das Freuen schwierig werden. Die Schwierigkeit kann aber auch von einer anderen Seite kommen: freuen ist nicht nützlich. Es ist eine Eigenschaft der Technik beziehungsweise des auf ihr wachsenden Geschäftes, die Welt in nützliche und unnützliche Dinge einzuteilen. Um das Geschäft zu vergrössern, werden die unnützlichen Dinge mit den Mitteln der Technik in nützliche verwandelt. Das hat zur Folge, dass in den Technokratien die Freude abnimmt, und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit. Mit eben derselben Geschwindigkeit, mit der die Zahl der Maschinen und das damit verbundene Geschäft zunimmt.
Ein Kriterium der Schönheit darf als gewiss betrachtet werden: schöne Dinge werden mit dem Alter nicht hässlich. Wahre Architektur ist auch noch als Ruine schön! Ich darf Sie an die Baudenkmäler der Antike erinnern. Gute Bildhauerei darf ruhig alt werden. Ihre Schönheit kommt auch noch in ihren Fragmenten zum Ausdruck. Bitte betrachten Sie moderne Gebäude und stellen Sie sich die eintönigen Fassaden im Alter vor, wenn die Kunststoff- und Plastikschminke zerfallen ist. Eine Ahnung davon kann beim Anblick eines Gebäudes erworben werden, das zehn oder höchstens zwanzig Jahre steht und dessen Putz nicht mehr erneuert wurde. Solche Ahnungen sind unheilschwanger. Beton und modernes Ingenieurwissen haben es möglich gemacht, die Architektur durch das Architektendiplom und die Schmetterlingskrawatte zu ersetzen.
Da gibt es noch ein weiteres, sicheres Kriterium für Schönheit: alle Formen, Gestalten und Farben, die von der Natur geschaffen wurden, sind schön. Die hässlichen Stellen der Erde sind immer dort zu finden, wo die Menschen mit Hilfe der Technik Geschäfte machen. Je grösser das Geschäft, um so hässlicher die Gegend. Gegen die unbedingte Schönheit natürlicher Dinge liegen Einwände auf der Zunge. Zum Beispiel kann an gewisse Produkte des Stoffwechsels gedacht werden. Aber ich wage zu sagen, dass ein Dunghaufen immer noch schöner ist als beispielsweise ein Autofriedhof.
Die Schönheit der Gestalt ist für alles Lebendige von tiefgreifender Bedeutung. Schönheit ist nicht mit Zahlen erfassbar. Die Bemühungen der exakten Naturwissenschaften aber bestehen darin, die Qualitäten der Natur auf messbare Grössen zu reduzieren. In dieser Hinsicht ist das Phänomen der Schönheit auch Gegenstand unserer Kritik.
Mit der Schönheit hängen auch die Begriffe Zeit und Dauer zusammen. Die Wesen der Natur leben in der Dauer. Die exakten Naturwissenschaften messen ihre Abläufe mit der Zeit. Dauer liegt zwischen zwei Herzschlägen, zwischen Blüte und Frucht oder zwischen Geburt und Tod. Zeit aber wird mit periodisch wiederkehrenden Vorgängen in Maschinen verschiedenster Konstruktion gemessen. Diese Maschinen heissen Uhren. Es gibt heute viele Uhren, aber wenig Zeit, beziehungsweise wenig Dauer. Denn was das Leben braucht, ist Dauer. Der wesentliche Unterschied zwischen Zeit und Dauer besteht darin, dass Dauer nicht gemessen werden kann, da sie dem Lebendigen zugeordnet ist. Leben kann nicht gemessen werden. Die Dauer eines Lebens mit irgendeiner Uhr messen zu wollen, ist ein Unsinn. Es gilt dies auch in Hinsicht auf die relativistische Zeitkontraktion.
Zur Gestaltung von schönen Dingen braucht es Dauer. Nur was in der Dauer entsteht, kann schön sein. Dauer kann niemals gekürzt werden, weil sie im Rhythmus des Lebens fliesst und weil alles Lebendige gegeben ist. Viele Prozesse der exakten Naturwissenschaften und somit auch technische Prozesse können beschleunigt werden. Das heisst, die Zeit für den Ablauf kann gekürzt werden. Auch darin unterscheidet sich die Zeit von der Dauer. Eben weil die Dauer ein Mass des Lebens ist, kann sie nicht, wie die Zeit, gedehnt oder gerafft werden. Sie ist ein Mass, das nicht mit den Dimensionen der Physik festgelegt werden kann.
Um mit den Mitteln der Technik etwas herzustellen, braucht es Zeit. Die benötigte Zeit hängt vom angewendeten technischen Prozess ab. Je nach Wille des Technikers können in einer bestimmten Zeit mehr oder weniger der gewünschten Dinge hergestellt oder, um das treffende Wort zu verwenden, fabriziert werden. Dies ist das Prinzip der Fabrikation. Jede gewünschte Menge kann in einer bestimmten Zeit fabriziert werden. So etwas ist bei einem Lebewesen undenkbar; sein Werden und Vergehen ist an die ihm gegebene Dauer gebunden. Mit keinem Mittel der Wissenschaft kann es aus der Dauer befreit werden. Alles Leben ist gebunden.
Massenfabrikate entstehen immer in der mit den Uhren messbaren und daher auch kürzbaren Zeit. Da schöne Dinge immer der Dauer bedürfen, können Massenfabrikate niemals schön sein. Darin liegt übrigens ein Unterschied zwischen Handwerk und Fabrikation.
Zum Abschluss unserer Betrachtungen über den Wert einer Kritik soll festgehalten werden, dass wir eine Kritik der Bemühung, der Bescheidenheit und der Demut anstreben wollen. Das heisst, dass daraus niemals eine Schule entstehen kann. Denn Bemühung, Bescheidenheit und Demut müssen unabhängig im Herzen eines jeden Einzelnen leben. Es kann daher bei unseren Betrachtungen und Diskussionen nichts entstehen, das sich dazu eignen würde, eine Gesellschaft oder auch nur einen sogenannten Zirkel zu gründen. Recht haben wollen wir unter keinen Umständen. Immer wollen wir Fehler eingestehen. Immer soll der Nächste angehört werden; auch dann, wenn er recht haben will.
Vom Wesen der Wissenschaft
Die Wissenschaft ist eine Tätigkeit des Menschen. Das klingt wie eine Binsenwahrheit. Es ist auch eine! Doch hin und wieder muss auf Binsenwahrheiten aufmerksam gemacht werden. Denn nicht selten geraten diese auf Grund allzu emsiger Beschäftigung in Vergessenheit. Dies gilt auch für die Wissenschaft, deren Tätigkeit heute ausgesprochen emsig ist. Besonders bei den Naturwissenschaften kann übereifriges Forschen zur irrigen Annahme führen, diese Wissenschaft sei nicht das Produkt menschlicher Tätigkeit, sondern ein integrierter Teil der Natur selbst. Da es sich dabei um eine Überbewertung menschlicher Tätigkeit handelt, muss dieser Irrtum als gefährlich betrachtet werden. Und weil es sich um eine nicht geringfügige Überschätzung handelt, ist die Gefahr entsprechend gross. Daher sei die Binsenwahrheit expressis verbis gesagt: «In der Natur gibt es keine Naturwissenschaft.» Die Naturwissenschaft existiert allein im menschlichen Geist und nimmt durch die Tätigkeit des Menschen Gestalt an. Die Natur ist eine Gegebenheit. Das Wesen der Naturwissenschaft wird vom Menschen geprägt und wandelt sich daher rasch und willkürlich. Willkür ist wörtlich zu verstehen, das heisst etymologisch: Wahl des Willens. Ein Kurfürst, oder mittelhochdeutsch Kürvürste, war ein mit dem Recht zur Königswahl ausgestatteter Reichsfürst.
Wissenschaft wird heutzutage mit einer ganz besonderen Emsigkeit betrieben. Warum? Hauptsächlich deshalb, weil sie heute zum Erwerb von Geld ausgeübt werden kann. Das ist verhältnismässig neu; hundert, höchstens aber zweihundert Jahre mögen seit dem ersten vollamtlichen Berufswissenschaftler verstrichen sein. (Der Ausdruck «vollamtlich» in Hinsicht auf Wissenschaftler stammt aus dem Vokabular der Universität Basel.) Auf das ist die Tatsache zurückzuführen, dass 90 % aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute leben. Heute kann man von der Wissenschaft leben. Vorher wurde die Wissenschaft in der Hauptsache zum Erwerb von Verständnis um die Gegebenheiten der Welt und der Natur ausgeübt. Zu jener Zeit war das Hungern eine anerkannte Existenzmöglichkeit für die Wissenschaftler. Es fiel niemandem ein, sich daran zu stossen. Das hat sich grundlegend geändert. Wer möchte es den Wissenschaftlern nicht gönnen? Am Deutschen Museum in München ist der neue Aspekt angeschrieben: «Wissen ist Macht.» Macht kann Nahrung verschaffen. Um die Nahrung drängen sich die Hungrigen, essen, werden satt und vermehren sich.
Wenn die Wissenschaft früher unter dem Ansporn des Fastens stand, so sonnt sie sich heute in der Zufriedenheit des Sattseins. Ich bin der Ansicht, dass dieser Aspekt nicht unwesentlich ist. Denn sowohl Fasten wie auch Sattsein erzeugen eine Prägung im Antlitz des Menschen.
Unter Antlitz wollen wir den ganzen Ausdruck des innern und äusseren Seins verstehen. Die Innerlichkeit mag hier als undefinierter Begriff auffallen. Warum? Weil wir uns an eine bestimmte Denkweise gewöhnt haben. An die der exakten Naturwissenschaften nämlich. Denn im Rahmen dieses Denkens gibt es keine Innerlichkeit.
Deshalb fällt der Begriff auf und wird gezwungen, sich zu rechtfertigen. Unsere Aufgabe soll es nicht sein, die Innerlichkeit zu rechtfertigen. Vielmehr wollen wir die Innerlichkeit als etwas Bestehendes und sogar auf der Hand Liegendes sehen lernen. Das wird nicht einfach sein, denn sehen ist schwierig.
Zurück zum Sattsein und zum Fasten. Da die Wissenschaft vom Menschen hervorgebracht wird, wird ihr Wesen vom Menschen abhängen. Da ein Mensch, der fastet, ein anderes Antlitz hat als ein Mensch, der sich satt sein lässt, wird auch Fasten und Sattsein das Wesen der Wissenschaft prägen. Die Wissenschaft der Fastenzeit war eine andere als die Wissenschaft der vollen Fleischtöpfe. Dies ist in Hinsicht auf eine Kritik der Wissenschaft eine nicht unwesentliche, aber auch eine nicht gerne gesehene Tatsache. Denn ein hauptsächlicher Zug des Wesens der Wissenschaft besteht darin, dass Wissenschaft nicht etwa in der Natur gegeben ist, sondern vom Menschen hervorgebracht wird. Das muss betont werden, da es vielfach geschieht, dass sich der Beschäftigte, nachdem er seine Tätigkeit eine gewisse Zeit ausgeübt hat, mit dem Gegenstand seiner Beschäftigung identifiziert. Ich möchte zum Beispiel an den Staatsbeamten erinnern, der sich nach einigen Dienstjahren gerne mit dem Staat verwechselt.
So geschieht es auch gerne, dass sich Naturwissenschaftler mit der Naturwissenschaft identifizieren, welche sie dann in einem nächsten Schritt mit der Natur selbst verwechseln. Es ist ein hauptsächlicher Teil des Wesens aller Wissenschaft, dass sie durch menschliche Tätigkeit entstanden ist und niemals selbständig in der Natur vokommt. Da alle menschliche Tätigkeit von der Verfassung und vom Zustand der Tätigen beeinflusst wird, ist auch das Wesen der Wissenschaft nicht unbedeutend von der Befriedigung des Appetits abhängig. Die vollsten Fleischtöpfe sind heute bei den exakten Naturwissenschaften zu finden. Somit ist auch ihr Wesen durch die Folgen der Sattheit geprägt. Natürlich handelt es sich dabei nicht um den Kern des Wesens.
Man kann mir den Vorwurf machen, es wäre nicht nötig gewesen, dies an den Anfang einer Diskussion über das Wesen der exakten Naturwissenschaften zu stellen. Ich weiss, es ist unhöflich, jemanden auf sein Bäuchlein aufmerksam zu machen. Aber ich habe diesen Aspekt an den Anfang gestellt, da die Sattheit im Gegensatz zum Hunger gerne vergessen wird. Ihr Einfluss auf das Wesen der exakten Naturwissenschaften wird daher meist vergessen.
Die Sattheit ist heute ein bedeutender Punkt im Wesen der Wissenschaft. Wer das bezweifelt, kann in Gedanken die Probe aufs Exempel machen. Nämlich: Man nehme der Wissenschaft die Fleischtöpfe weg und sehe, wie viele Wissenschaftler übrigbleiben. Würden dann immer noch 90 % aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute leben? Die Kunst hat es offenbar einfacher. So kann man von dort beispielsweise folgendes hören: Ein Schauspieler beklagte sich bei seinem Regisseur über seine wirtschaftliche Lage. Dieser wurde zynisch, indem er ihm antwortete: «Ich möchte Sie auf die Möglichkeit, für die Kunst zu hungern, aufmerksam machen.» Immerhin, Wissenschaft und Kunst unterscheiden sich noch in anderen Dingen.
Wir wollen uns jetzt dem Kern der Wesens wissenschaftlicher Tätigkeit zuwenden. Beim Wort Kern denken wir immer an ein Inneres, von dem wegweisende und gestaltende Kräfte ausgehen. Wir fühlen, dass alles Sein sich in einem Zentrum trifft, von wo ein Kern seine richtenden Kräfte ausstrahlt. Das Sein der Natur besteht in sich selbst und unmittelbar. Die Existenz der Wissenschaft aber ist nicht ein gegebenes Sein, sondern eine Folge des von menschlichem Sein getragenen Denkens. Die Wissenschaft existiert also mittelbar, eben durch das Mittel Denken. Daher ist die Wissenschaft, im Gegensatz zu den Dingen der Natur, dem Irrtum unterworfen. Daran sollte ganz besonders dann gedacht werden, wenn mit den Mitteln der Wissenschaft und Technik in die Natur eingegriffen wird. Die Natur irrt sich nie. Es sei denn, dass sie sich im Menschen geirrt hat, der als einziges Geschöpf wissenschaftlich zu denken vermag und dieses Denken auf die Natur in einer Art und Weise anwendet, als ob es keine Irrtümer gäbe.
Mit dieser Betrachtung haben wir - allerdings an einer schwachen Stelle - den Kern des Wesens aller wissenschaftlichen Tätigkeit berührt. Das Denken! Ich weiss, es ist nicht besonders höflich, beim Vorstellen zuerst auf die Schwächen hinzuweisen. Aber das Denken ist eine zu ernste Sache, als dass mit ihm höflicher Umgang gepflogen werden könnte. Ausserdem wollen wir hier in Ehrlichkeit Kritik betreiben. Allzuhäufig wird das Denken überschätzt. Bei der Anwendung der Ergebnisse des Denkens wird oft so gehandelt, als ob es keine Irrtümer gäbe. Dort, wo das Denken zu Überzeugungen geführt hat, ist der Weg zum Irrtum nicht mehr weit.
Dass das Denken der Kern jeder wissenschaftlichen Tätigkeit ist, liegt auf der Hand. Aber es sind gerade die auf der Hand liegenden Dinge, die leicht zu Selbstverständlichkeiten werden. Und Selbstverständlichkeiten sind diejenigen Dinge, über die meist nicht mehr nachgedacht wird. Daher sei noch einmal gesagt: der Kern aller Wissenschaften besteht in dem vom Menschen ausgeübten Denken und nicht etwa in einer in der Natur vorkommenden oder die Natur durchdringenden Gegebenheit. Diese Tatsache ist besonders für die Naturwissenschaften von bemerkenswerter Wichtigkeit. - Die Naturwissenschaften kommen nicht in der Natur, sondern im Denken der Naturwissenschaftler vor.
Trotzdem dies leicht einsehbar ist, wird immer wieder versucht, eine Art von mixtura mirabilis aus Natur und Naturwissenschaft herzustellen. Ein Beispiel aus der neuesten Zeit soll genannt werden. Das Denken wird dabei als Ursprung der Wissenschaft erkannt und anerkannt. Da man die Naturwissenschaften, vor allen Dingen die exakten Naturwissenschaften, gerne in der Natur bestätigt sehen möchte, wird ein Mittel gesucht, mit welchem das Denken auch ausserhalb des Menschen, gewissermassen in der Natur selbst, erzeugt werden kann. Ein solcher deus ex machina sollte sich dann am Busen der Natur nähren und mit dieser Nahrung deren fehlerlose Geschlossenheit in sich aufnehmen. Das Denken könnte dann gewissermassen von aussen betrachtet werden.
Es werden heute mit den Möglichkeiten der Elektronik Maschinen gebaut, die als künstlich hergestellte Teile der Natur das hervorbringen sollen, womit wir die Wissenschaft aufbauen - das Denken. Die Idee ist nicht schlecht, das wäre den Stier bei den Hörnern gepackt.
Aber die Sache hat einen Haken. Und zwar das Denken selbst. Bevor man eine Maschine baut, die denken können soll, muss man sich darüber im klaren sein, was Denken ist. An anderer Stelle wollen wir diesem Problem besondere Aufmerksamkeit schenken. Als Hinweis und Andeutung soll lediglich vorweggenommen werden, dass zwischen dem Denken und dem Produkt eines sogenannten Elektronengehirns der gleiche prinzipielle Unterschied besteht wie zwischen einem Lebewesen und einer Maschine. Die Betrachtung und Darstellung dieses offenbaren Unterschiedes soll ein Hauptgegenstand unserer Kritik sein. Was vor Augen liegt, ist offenbar. Doch die Offenbarung entsteht erst im Menschen. Dazu bedarf es des Sehens. Sehen aber ist schwer. Wir sollten versuchen, es zu lernen. Die Natur ist voll von Dingen, die gesehen werden wollen. Die Geschöpfe haben nicht nur die Augen als Organe des Sehens, sondern auch Gestalt, Form und Farbe als Organe des Gesehenwerdens. Immer wieder und mit den schönsten Beispielen macht ADOLF PORTMANN auf diese Gegebenheit aufmerksam.
Mit Hilfe von «Elektronengehirnen» wird versucht, das Denken ausserhalb des Menschen sich abspielen zu lassen. Es soll dann unabhängig von aller menschlichen Subjektivität untersucht werden können. Dieser Versuch der Subjekt-Objekt-Trennung ist für die exakten Naturwissenschaften charakteristisch. Es soll unabhängig von menschlichen Einflüssen beobachtet werden, um zu absoluten Resultaten zu kommen. Absolut heisst in diesem Falle Ausschluss subjektiver Einflüsse. Wenn es sich um Gegebenheiten handelt, die ausserhalb des Menschen sind, so kann durchaus zur Diskussion gestellt werden, wieweit es überhaupt möglich ist, subjektive Einflüsse auszuschliessen. Doch beim Denken handelt es sich um eine der innersten Fähigkeiten des Menschen, also des Subjektes selbst. Das Denken ist mit dem Menschen mindestens so verwachsen wie die Haare, an welchen sich Freiherr HIERONYMUS VON MÜNCHHAUSEN aus dem Sumpf gezogen hat. Der Versuch, das Denken mit dem Denken zu verstehen, dürfte mit ähnlichen Schwierigkeiten verknüpft sein wie die Bemühung, das Leben mit dem Leben zu erfassen. Was wir verstehen können, ist bloss das, was wir selbst mit Hilfe unseres Denkens hervorbringen. Eine Maschine zum Beispiel. Deshalb gibt es Naturwissenschaftler, die in einem Lebewesen eine verfeinerte Maschine sehen wollen. Begreiflich, denn damit klammern sie sich an die einzige Möglichkeit, das Leben rational zu verstehen. Aber weder Leben noch Denken können wir mit dem Denken hervorbringen. Beides sind Gegebenheiten der Natur. Um ein Haus von aussen zu sehen, müssen wir es verlassen. Nach dem Aussen des Lebens führt nur die einseitig sich öffnende Pforte des Todes. Ob uns von dort her das Geheimnis des Lebens offenbart wird, ist für alle Lebenden eine Frage des Glaubens. Im Leben kann das Leben nicht von einem Aussen her betrachtet und aus dieser Sicht verstanden werden.
Es ist möglich, auf viele Arten zu denken. Das wissenschaftliche Denken ist durch das ausgezeichnet, was wir Methode nennen. Es kann aber auch ohne Methode gedacht werden. Das meiste Denken wird ohne das durchgeführt, was von der Wissenschaft als Methode anerkannt ist. Politik, Geschichte, Gesellschaft und Familienleben basieren auf einem Denken, über das die Wissenschaft die Nase rümpft. Offen bleibt in jedem Fall die Frage, welches Denken das bessere oder richtigere ist. Immer sollte bedacht werden, dass jede Epoche die Tendenz hatte, ihre Kräfte zu überschätzen. Heute sind wir geneigt, das Vermögen der Wissenschaft zu überschätzen. Dies sei hervorgehoben und betont für all diejenigen, die es zumindest für nicht ausgeschlossen halten, dass «Elektronengehirne» oder, bescheidener ausgedrückt, Rechenmaschinen denken können. Übrigens ist zu bemerken, dass das Verb «können» im missbräuchlichen Sinne des Elektronikerjargons verwendet wurde. Eine Maschine «kann» natürlich nichts; eine Maschine läuft ab.
Das Wesen aller wissenschaftlichen Tätigkeit ist durch die Methode geprägt. Sie stellt den eigentlichen Kern dar. So wie sich die verschiedenen Wissenschaften voneinander unterscheiden, unterscheiden sich auch ihre Methoden. Doch haben alle Methoden gemeinsame Züge. Allgemeinste Grundlage ist immer die Logik; aber eben, nur allgemeinste Grundlage. Die Logik allein reicht zur Strukturierung einer Methode nicht aus. Im weiteren zeichnen sich alle Methoden durch die Regelmässigkeit der Verfahren aus, die angewendet werden, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Daher ist die Methode in ihrer Anwendung nicht auf die Wissenschaften beschränkt, sondern ist auch in den Geschäften des täglichen Lebens mehr oder weniger ausgeprägt anzutreffen. Aber zweifellos erscheint die Methode am ausgeprägtesten in den Wissenschaften. Das wissenschaftliche Denken legt sich eine Disziplin auf, welche die Anwendung der gewählten Methode verschärft. Diese Disziplin besteht darin, dass Aspekte, die der Struktur der Methode fremd sind, ausgeschlossen werden. Die Anwendung einer wissenschaftlichen Methode stellt daher eine permanente Selektion der Umwelt dar. Somit werden bei einer wissenschaftlichen Betrachtung die zur angewandten Methode passenden Dinge aus der Mannigfaltigkeit der Welt ausgesucht. Das ist ein wesentlicher Zug wissenschaftlicher Tätigkeit. Dem Denken wird einerseits der Zwang der Methode auferlegt und andererseits wird von ihm verlangt, sich auf diejenigen Dinge zu beschränken, welchen die Struktur der Methode angepasst wurde.
Das sich freiwillige Auferlegen einer solchen Beschränkung gehört zu den Kennzeichen einer Methode und ist bei den Methoden der Wissenschaft ganz besonders ausgeprägt. Aus der unübersehbaren Mannigfaltigkeit der Welt soll mit Hilfe der Methode ein überblickbares Feld ausgeblendet werden. Eine solche Beschränkung ist solange vernünftig, als sich der ausübende Wissenschaftler ihrer bewusst ist. Ohne die von der Methode bewusst eingeschränkte Sicht wäre eine wissenschaftliche Betrachtungsweise ausgeschlossen, da es unserem Intellekt ganz einfach versagt ist, die Welt in ihrer Ganzheit zu erfassen. Allerdings ist diese allumfassende, das Letzte und Kleinste durchdringende Ganzheit eine Tatsache, die uns offenbar ist. Aber diese Offenbarung besteht in der Beziehung unserer Ganzheit zur Ganzheit der Welt. Die Ganzheit unseres Seins besteht eben aus mehr als nur dem Intellekt. Ein rationales Erfassen der Ganzheit ist uns daher nicht vergönnt, da die Ratio an den Intellekt gebunden ist. Dies sich vor Augen zu halten, ist für den Wissenschaftler mindestens so Pflicht wie die konsequente Anwendung seiner Methode. Denn nur so kann eine Überbewertung wissenschaftlicher Betrachtungsweisen vermieden werden.
Der Gefahr einer Überbewertung ist jede Wissenschaft ausgesetzt. Denn die der Methode inhärente Einschränkung führt etwa nicht dazu, dass auch das wissenschaftliche Tätigkeitsfeld eingeschränkt wird. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Durch die Anwendung der Methode auf die Dinge der Welt kann das entstehen, was wir ein Forschungsergebnis nennen. In einem solchen Ergebnis ist in der Regel eine Antwort auf die eine Frage enthalten, die im Rahmen der Methode an die in Betracht gezogene Substanz gestellt wurde. Es ist nun das Charakteristische an einem solchen Forschungsergebnis, dass es nicht nur eine Antwort, sondern unter dem Gesichtspunkt der Antwort auch neue Fragen bringt. Somit engt sich der Fragenkreis nicht etwa ein, sondern weitet sich aus. Und zwar handelt es sich um eine exponentiell zunehmende Ausweitung, da in der Regel mit einer beantworteten Frage mehrere neue Fragen auftauchen. Dies führt zu einer immensen Beschäftigung. Immer mehr Wissenschaftler arbeiten an den neu entstandenen Problemen, deren Lösung wiederum zu neuen Fragen führt. Diese Tatsache trug auch dazu bei, dass 90% aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute leben. Die Gefahr einer Überschätzung der Wissenschaft wird durch diese emsige Forschertätigkeit gross. Dazu kommen noch die technischen Erfolge. Es soll schon an dieser Stelle betont werden, dass technische Erfolge und Wissenschaft verschiedene Dinge sind. Noch verschiedener sind Erfolg und Richtigkeit. Mindestens so verschieden wie Richtigkeit und Wahrheit.
Das Phänomen der sich vermehrenden Fragen ist für die Wissenschaft charakteristisch und gehört somit zu ihrem Wesen. Nun sieht es die Wissenschaft als ihre Aufgabe, auf alle im Verlauf ihrer Tätigkeit aufgetauchten Fragen einzutreten. Ähnlich verhält sich übrigens die Technik, die sich anscheinend verpflichtet fühlt, alle ihre Möglichkeiten auch in die Tat umzusetzen. Das Eintreten auf die neu aufgetauchten Fragen hat zur Folge, dass die ursprünglich angewandten Methoden nicht mehr tauglich sind. Und zwar besteht der Mangel nicht darin, dass die der Methode inhärenten Begrenzungen für die weiteren Betrachtungen zu eng geworden wären. Das Gegenteil ist der Fall! Bei der Bearbeitung eines neu aufgetauchten Problemkreises muss die Methode diesem angepasst werden, was eine zusätzliche Einschränkung in Hinsicht auf das Ganze erfordert. So entstehen aus Fachgebieten Spezialgebiete, die wieder zu Fachgebieten werden. Dieser durch die wissenschaftliche Methode prädestinierte Zerfall in Spezialgebiete gehört mithin zum Wesen der Wissenschaft. Dies geht eindeutig aus der Geschichte der Wissenschaft hervor. Die Ursache dafür besteht in der Tatsache, dass eine intellektuelle Betrachtung der Geschehnisse und Zusammenhänge der Welt nur durch das Mittel der Methode möglich ist, die sich um ihrer Existenz willen bewusste Beschränkungen auferlegen muss. Wie die Erfahrung zeigt, haben diese Beschränkungen immer weitere Beschränkungen zur Folge. Mit dem Zerfall in Spezialgebiete wird der Blick auf die Ganzheit der Welt nicht erweitert, sondern eingeschränkt. Diese Tatsache, die nichts anderes als eine zwangsläufige Folge der wissenschaftlichen Methode ist, muss bei jeglicher wissenschaftlichen Tätigkeit klar vor Augen stehen. Klarheit über diesen Zug des Wesens der Wissenschaft verhindert vor allen Dingen eine Überschätzung wissenschaftlicher Möglichkeiten. Voraussetzung für solche Einsicht ist der Wille zur Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Oder wie MAX WEBER sagt: «Es sollen keine unbewussten oder bewussten Werturteile in die wissenschaftliche Arbeit eingeschmuggelt werden.»
Es ist wohl möglich, Einzelheiten im Rahmen der angewandten Betrachtungsweise bzw. Methode zur Darstellung zu bringen. Aber eine in der Ganzheit der Welt gültige Antwort auf die auch nur an eine kleinste Einzelheit gestellte Frage gibt es niemals. Wenn eine Antwort vorliegt, so hat sie höchstens im Bereich der angewendeten Methode Gültigkeit. Oder auf einen Nenner gebracht: Wegen des divergierenden Charakters aller wissenschaftlichen Tätigkeit kann die Ganzheit und Geschlossenheit der Welt nicht mit den Methoden der Wissenschaft erfasst werden.
Alle wissenschaftliche Tätigkeit kann als eine Betrachtung der Welt aus der Perspektive der jeweils angewendeten Methode angesehen werden. In den verschiedenen Wissenschaften erscheinen daher die Dinge der Welt immer unter verschiedenen Aspekten. Dies zeigt unter anderem auch deutlich den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Natur. In der Natur erscheinen die Dinge nicht, sondern sie sind. Mit der Methode wird versucht, die Mannigfaltigkeit der Welt auf ein solches Mass zu reduzieren, das der Beschränkung unseres Intellektes eine Betrachtung und Ordnung der Dinge ermöglicht. Jede wissenschaftliche Darstellung stellt somit eine Reduktion der Wirklichkeit, mit der wir die Ganzheit der Welt bezeichnen wollen, auf das Vermögen des Intellektes dar. Dieser Reduktion, die im Vergleich zur Ganzheit der Welt beliebig gross ist, müssen wir uns bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer bewusst sein. Aus dieser Distanz gesehen scheint diese Einsicht zu den selbstverständlichsten Dingen der Welt zu gehören.
Aber jede Tätigkeit erfordert Kontakt mit und nicht Distanz zu den Objekten. So auch die wissenschaftliche Tätigkeit. Je intensiver die Arbeit ist, um so inniger wird der Kontakt und um so kleiner ist die Distanz. Es entsteht dann die Gefahr, dass vor läuter Bäumen der Wald nicht mehr gesehen wird. So kann in der Anwendung der Methode der Wald zum Baum, der Baum zum Blatt, das Blatt zur Zelle, die Zelle zum Chloroblasten und der Chloroblast zum Chlorophyllmolekül zusammenschrumpfen. Am Schluss besteht das Grün des Waldes aus nichts anderem als aus den Absorptionsbanden des Chlorophylls. Eine solche Folge ist zwangsläufig, da jede wissenschaftliche Methode auf dem Prinzip der Einschränkung und Ausschliessung beruht. So führt ihre konsequente Anwendung aus der Fülle der Welt zu immer weniger und weniger. Es sei mir gestattet, an die folgende zynische Feststellung zu erinnern: «Ein Spezialist ist ein Mensch, der von weniger und weniger immer mehr und mehr versteht, bis er am Schluss von nichts alles versteht.» -- Durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden zerfällt die Universitas in einem zunehmend divergierenden Prozess in immer mehr Spezialgebiete. Wegen der Mannigfaltigkeit der Welt auch in ihren kleinsten Bereichen hat dieser Zerfallsprozess kein Ende. Wer Wissenschaft betreiben will, darf sich daran nicht stossen. Wer sich Gedanken darüber macht, wird ein unangenehmes Gefühl nicht mehr los. Das Gefühl kann sogar sehr unangenehm werden.
Da der Intellekt vom Menschen getragen wird, besitzt er eine typisch menschliche Eigenschaft; er möchte sich nämlich für seine Bemühungen belohnt sehen. Im Bereiche der wissenschaftlichen Tätigkeit lässt er sich seinen Lohn gerne in Form von Resultaten ausbezahlen, welche die Wirksamkeit der angewendeten Methode bestätigen. Im Gerechtigkeitsempfinden des Menschen ist die Meinung verankert, dass der Lohn der aufgewendeten Arbeit äquivalent sein soll. Das heisst, für eine grosse Arbeit wird ein grosser Lohn erwartet. Da die Struktur der wissenschaftlichen Tätigkeit einen exponentiell divergierenden Charakter hat, wird ein Wissenschaftler durch nichts gehindert, für die Bearbeitung eines winzigen Teils der Natur einen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit aufzuwenden. Aus solchem Tun besteht dann auch die Arbeit der meisten Wissenschaftler. Es ist dies mitunter auch ein Grund, warum 90 % aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute leben. Wenn diese Tatsache anerkannt und als solche hingenommen wird, ist alles in Ordnung. Doch ist eine solche Bescheidenheit dem Gerechtigkeitsempfinden zuwider. Denn: grosse Arbeit - grosser Lohn. Wer möchte schon für einige Winzigkeiten ein ganzes Leben lang gearbeitet haben. So fordert denn dieses Gerechtigkeitsempfinden, dessen Vater, wie wir eingestehen müssen, der Ehrgeiz ist, ein Äquivalent für das «Lebenswerk».
In der Ausübung solcher Gerechtigkeit wird nun etwas getan, das bei einer Betrachtung über das Wesen der Wissenschaft nicht vergessen werden darf. Dieses Vorgehen könnte etwa mit dem bezeichnet werden, das man den « Stiel umdrehen» nennt. Ich stelle mir vor, dass dieses Sprichwot t aus jener Zeit stammt, wo mit Lanzenspitzen versehene Stiele ihre Anwendung fanden. Diese «Umkehr des Stieles» wird in der Wissenschaft öfter als man glaubt durchgeführt. Die Finte erfreut sich sogar solcher Beliebtheit, dass sie immer wieder mit einer wissenschaftlichen Methode verwechselt wird. Es wird dabei folgendermassen vorgegangen: Eine Gegebenheit der Welt wird mit einer ihr entsprechenden wissenschaftlichen Methode bearbeitet. Entsprechend den der Methode inhärenten Einschränkungen werden Resultate erhalten, die gegenüber der ursprünglichen Gegebenheit auf ein dem Intellekt zugängliches Mass reduziert sind. Diese Reduktion ist in allen Fällen so gross, dass sie offensichtlich sein muss. Dies nun ist der Punkt, an dem der « Stiel» umgedreht wird. Statt die Diskrepanz zwischen der Natur und dem wissenschaftlichen Resultat in Bescheidenheit zu anerkennen, wird die dem Forschungsergebnis anhaftende Beschränkung dem Gegenstand der Forschung selbst, das heisst dem in Betracht gezogenen Teil der Welt, zugeschrieben. Es handelt sich bei diesem Vorgehen um den ohnmächtigen Versuch, den Gegebenheiten der Welt den Willen der Wissenschaft aufzuzwängen.
Aus der Distanz gesehen kommt die Selbstgefälligkeit und nicht zuletzt Unwissenschaftlichkeit solchen Vorgehens klar zum Ausdruck. Doch bedarf es der Distanz. Und Distanz bedarf der Zeit und Musse; besser: der Dauer und Musse. Wo aber Dauer und Musse nicht zum Rüstzeug wissenschaftlicher Tätigkeit gehören, wuchern die Einzelheiten zu einem undurchdringbaren Dickicht, das den Blick auf die unabänderliche Gegebenheit der Dinge versperrt. Daher erfordert alle wissenschaftliche Tätigkeit eine Betrachtung aus der Distanz. Die dazu erforderliche Zeit und Musse ist ganz einfach aufzubringen. Andernfalls kann von Wissenschaft nicht die Rede sein. Es handelt sich höchstens um eine hektische Tätigkeit mit wissenschaftlichen Werkzeugen, die leicht, eben in Ausübung der erwähnten Gerechtigkeit, dazu führt, dass den Gegebenheiten der Natur die gefundenen Resultate aufgezwängt werden.
Aus einer solchen Sicht erscheint das « Umdrehen des Stieles» so unwissenschaftlich, dass wohl mancher an der Präsenz solcher Machenschaften zweifelt. Diese Zweifel sind durchaus verständlich, denn nichts sollte einem Wissenschaftler mehr zuwider sein als unwissenschaftliches Vorgehen. Und doch hat Kurzsichtigkeit immer wieder zu der paradoxen Annahme geführt, dass das, was durch die Anwendung einer wissenschaftlichen Methode hervorgebracht wurde, den in Betracht gezogenen Gegebenheiten selbst entsprechen soll. So wollte beispielsweise der berühmte MAUPERTUIS mit seinem lieben Kind, dem Prinzip der kleinsten Aktion, die Natur zur Sparsamkeit verpflichten. Solche Minimalbedingungen waren wohl in einzelnen Fällen zu finden. Doch war es offensichtlich, dass die Fülle der Welt einem «Geizprinzip» abhold sein musste. Mit seiner Ansicht, an der er besessen festhielt, zog er den Spott VOLTAIRES auf sich. Das war keine Kleinigkeit. Es gibt Wissenschaftshistoriker, die sagen, dass die spitze Feder VOLTAIRES MAUPERTUIS' Tod um etliche Jahre vorverlegt habe.
Wissenschaftliche Kurzsichtigkeit, die zu Irrtümern von der Art des genannten Beispiels führen, gehören keineswegs der Vergangenheit an. Im Gegenteil! Je mehr sich die Wissenschaft in Spezialgebiete auflöst, um so grösser wird die Gefahr, dass die Zusammenhänge in einer unübersehbaren Zahl von Einzelheiten untergehen. Um ein Beispiel aus der Gegenwart zu nennen, wollen wir uns der sogenannten molekularen Biologie zuwenden. Die molekulare Biologie versucht das Phänomen Leben aus der Sicht des Molekülbegriffes zu erforschen. Eines ihrer Teilgebiete wird die moderne Genetik genannt. Die modernen Genetiker sind der Überzeugung, dass die Vererbung nichts anderes als eine Folge der Struktur bestimmter Moleküle sei. Das Geheimnis der Vererbung könne daher mit der Kenntnis dieser Molekülstrukturen gelüftet werden.
Die Neigung, das von der Vererbung getragene Werden, Bestehen und Vergehen der Erscheinungsformen von Lebewesen in grober Näherung als eine Replikation zu betrachten, ist durchaus verständlich. Je nach der angewendeten Methode liegt eine solche Vorstellung ferner oder näher. Besonders heute, wo Vervielfältigungsmechanismen verschiedenster Art eine grosse Rolle spielen, drängt sich das Replikationsprinzip geradezu auf. Von der computergesteuerten Massenfabrikation über die Flut von gedruckten Worten und Bildern bis zum Stempel des Monsieur le bureau handelt es sich um Replikationen. So gesehen ist man sogar geneigt zu sagen, dass die Replikation ein wesentlicher Zug unseres Zeitalters sei. So wurde denn die Idee, dass hinter jeder Lebensform ein bestimmtes Klischee steht, als Arbeitshypothese in die Vererbungsforschung eingeführt. Die Fülle der Natur ist so reich, dass es meistens gelingt, für eine Idee etwas Passendes auszusuchen.
So haben FRANCIS CRICK, JAMES WATSON und MAURICE WILKINS in den Molekülen der in Zellkernen vorkommenden Desoxyribonukleinsäure eine Struktur gefunden, welche im Bereich molekularer Dimensionen einen Replikationsmechanismus denkbar macht. Der wissenschaftliche Wert dieser Entdeckung ist bedeutend. Den Forschern wurde für diese Arbeit im Jahre 1962 der Nobelpreis für Medizin verliehen. Schon die Tatsache, dass der Preis für Medizin und nicht etwa für Chemie verliehen wurde, ist ein Hinweis für die Überschätzung der unter der Idee der Replikation gemachten Entdeckung. Was wirklich vorliegt, ist ein Makromolekül, dessen Struktur die Möglichkeit zulässt, dass auf Grund eines vorhandenen Moleküls durch Replikation weitere, gleiche Moleküle aufgebaut werden können.
Trotzdem hat sich die unwissenschaftliche Behauptung durchgesetzt, dass die Vererbung nichts anderes als eine Folge der Replikation von Desoxyribonukleinsäure-Molekülen sei. Hemmungslos wird von einem, diesen Molekülen inhärenten genetischen Code, mit welchem der Wissenschaft der Schlüssel zum Geheimnis der Vererbung in die Hände gegeben sei, gesprochen. Sowohl in Fachzeitschriften, in populärwissenschaftlichen Büchern, im Reader's Digest als auch in Tageszeitungen kann darüber gelesen werden. Die Vererbung ist nur noch eine Frage der Sequenz von Nukleotiden, aus welchen die Desoxyribonukleinsäure aufgebaut ist. Die Frage, wie das Wesentliche der Vererbung, eben die werdende, seiende und vergehende Gestalt der Lebewesen, aus einer solchen codeträchtigen Sequenz entstehen soll, wird entweder ignoriert oder deren Beantwortung als eine Frage der Zeit bezeichnet. Die « Frage der Zeit» ist übrigens ein recht oft und gerne gebrauchtes Mittel zur Stärkung der schwachen Stellen von Theorien. Im Grunde genommen handelt es sich bei solchen Argumentationen um dialektischen Materialismus.
Mit der Ansicht der molekularen Genetik haben wir es mit einem jener Fälle zutun, wo ein mit Hilfe einer wissenschaftlichen Methode gefundenes Resultat als eine Gegebenheit der Natur betrachtet wird. In Hinsicht auf die Irrtümlichkeit ist der vorliegende Fall zum zitierten Beispiel von MAUPERTUIS' «Sparsamkeitsprinzip» durchaus analog. Doch besteht in Hinsicht auf die Tragweite des Irrtums keine Analogie. Denn MAUPERTUIS' Behauptung wurde nicht als ein Mittel zur Rechtfertigung von eugenetischen Projekten verwendet.
Anders steht die Sache bei der molekularen Genetik. Obwohl die Bedeutung und Funktion der Desoxyribonukleinsäure in der Zelle in keiner Weise abgeklärt ist, genügt die blosse Existenz ihrer Moleküle gewissen Wissenschaftlern als Grundlage für ehrgeizige eugenetische Projekte. Dies ist ungeheuerlich. Besonders auch deshalb, weil sich auch Wissenschaftler, die als bedeutend bezeichnet werden, für solche Pläne hergeben. So modern ist diese Genetik.
Der wissenschaftliche Ehrgeiz tut in diesem Falle gleich zwei Dinge. Erstens will er, dass ein mit einer bestimmten Methode gefundenes Resultat eine Gegebenheit der Natur selbst sei. Und zweitens baut er auf diesem Irrtum ein Projekt, mit dem zutiefst in das menschliche Dasein eingegriffen werden soll. Noch einmal: das ist ungeheuerlich! Es ist somit nicht unbedeutend, darauf aufmerksam zu machen, dass die zum Wesen der Wissenschaft gehörenden Methoden auch Ursache von Irrtümern der eben dargestellten Art sein können.
Dieses Kapitel über das Wesen der Wissenschaft soll mit der Feststellung abgeschlossen werden, dass jede Methode vom Menschen als ein Zwang empfunden wird. Diesem Zwang versucht er auszuweichen. Das hat zur Folge, dass das unter der Matrix einer Methode durchgeführte Denken eher selten ist. Auch wenn heute viel mehr Wissenschaftler leben als früher, müssen wir uns dessen bewusst sein. Wenn sich der Mensch nicht den Zwang der Methode auferlegt, so denkt er fragmentarisch. Rhapsodisch abspringend geben sich seine Gedanken subjektiven Einfällen und Launen hin. Das ist das Denken des täglichen Lebens. Logik als allgemeinste Grundlage der Methode ist da kaum zu finden. Doch wäre es falsch, das Denken des täglichen Lebens als irrelevant zu betrachten. Vielmehr sollte es bei wissenschaftlichen Erwägungen in Betracht gezogen werden. Die Weltgeschichte wurde zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von diesem rhapsodischen Denken des täglichen Lebens geformt. Gerne ist die Wissenschaft bereit, die Irrtümer der Geschichte auf diese Art von Denken zurückzuführen. In Erinnerung an den vorausgehenden Abschnitt wollen wir uns vergegenwärtigen, dass es durchaus möglich ist, auch unter der Anwendung eines von der Methode getragenen wissenschaftlichen Denkens Irrtümer zu begehen. Je tiefer die Wissenschaften in das Leben eingreifen, um so grösser wird die Tragweite ihrer Irrtümer. Wenn sich die Wissenschaft mit der bisherigen Progression weiterentwickelt, so ist der Tag nicht mehr fern, an dem die wissenschaftlich begangenen Irrtümer diejenigen des täglichen Lebens sowohl hinsichtlich Zahl als auch Tragweite eingeholt haben werden.
Die exakten Naturwissenschaften
Diejenigen Naturwissenschaften, die nicht zu den exakten gehören, besitzen kein Epitheton. Sie heissen ganz einfach Naturwissenschaften. Dies bringt zum Ausdruck, dass die Naturwissenschaften nicht durch ein Prinzip des Gegenteils in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Denn der Ausdruck unexakte Naturwissenschaften existiert nicht. Die Bezeichnung «exakt» hat im Bereich der Naturwissenschaften eine Bedeutung besonderer Art erlangt, welche ein Gegenteil expressis verbis nicht verlangt. Und doch ist nicht zu übersehen, dass das Adjektiv «exakt» sein Gegenteil geradezu herausfordert. So kommt man nicht umhin, wenn von exakten Naturwissenschaften die Rede ist, zu fragen, worin die Exaktheit besteht und wo sie bei den anderen Naturwissenschaften fehlt.
Nicht nur innerhalb der Naturwissenschaften, sondern bei den Wissenschaften im gesamten finden wir eine Aufteilung in zwei Gruppen. Die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften. Dabei ist zu beachten, dass bei solchen Einteilungen niemals scharfe Grenzen trennend wirken. Die Übergänge vom einen zum andern Gebiet könnten etwa mit der Änderung der Farben im Spektrum des Sonnenlichtes verglichen werden. Stetig sind die Übergänge vom tiefsten Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau bis zum dunkelsten Violett. Niemand kann sagen, wo die Grenze zwischen zwei Farben liegt.
In Hinsicht auf eine ordnende Einteilung der Wissenschaften möchte ich auf zwei Gebiete aufmerksam machen, deren Zuordnung umstritten ist. Die Philosophie und die Mathematik. Was die Mathematik betrifft, wird oft die Frage gestellt, ob sie zu den Natur- oder Geisteswissenschaften gehöre. Die Frage hat ihren Ursprung in einer gewissen Ambivalenz der Mathematik. Einerseits ist sie zweifellos ein Kind des menschlichen Geistes. Andererseits können wir feststellen, dass gewisse Gestalten und Vorgänge in der Natur mathematischen Gesetzen zu gehorchen scheinen. Die Mathematik erscheint in der Natur gewissermassen manifestiert oder gar materialisiert. Aber mit dem Gehorchen ist Vorsicht geboten. Allzuleicht könnte der Wunsch, dass die Mathematik einen tieferen Ursprung als den menschlichen Geist hat, Vater dieses Gedankens sein. Denn wir wissen nicht, ob die Natur gehorcht, und wenn ja, wem sie gehorcht. Gerne hätten wir natürlich, wenn sie mathematischen Gesetzen gehorchen würde. Denn dann könnten wir die Natur mit den Werkzeugen der Mathematik in den Griff bekommen.
Wie wir gesehen haben, existieren die Wissenschaften nicht in der Natur, sondern im Geiste des Menschen. Das gilt auch für die Mathematik, denn sie ist eine Wissenschaft. Die wissenschaftlichste aller Wissenschaften sogar, wie die Mathematiker sagen. Daher ist es falsch zu sagen, die Natur gehorcht den Gesetzen der Mathematik. Denn wenn dem so wäre, müsste die Mathematik in der Natur existieren. Ausserhalb des menschlichen Geistes ist aber keine Spur von Mathematik zu finden. Somit ist es richtig und auch bescheidener zu sagen, gewisse Vorgänge und Zustände in der Natur lassen sich mit mathematischen Formulierungen beschreiben. Die Mathematik tritt also einerseits als ein von der Natur unabhängiges Produkt menschlichen Geistes auf, und andererseits können gewisse Teile der Natur mit Hilfe von mathematischen Gesetzen mehr oder weniger näherungsweise beschrieben werden. Ich betone: gewisse Teile und näherungsweise. Die meisten Teile der Natur lassen sich mathematisch nicht beschreiben, und keiner der mathematisch beschreibbaren Teile gehorcht dem angewandten Gesetz mit mathematischer Strenge. Diese Tatsache, die gerne mit mathematischer Grosszügigkeit übersehen wird, wirft klärendes Licht auf die Beziehung zwischen Mathematik und Natur.
Die Wurzeln der Mathematik gründen im menschlichen Geiste. Sie sollte daher den Geisteswissenschaften zugeordnet werden. Doch hat die Materialisierung mathematischer Gesetze durch mathematisch beschreibbare Gestalten und Vorgänge in der Natur der Mathematik einen naturwissenschaftlichen Charakter aufgeprägt. Diese Prägung entstand, obwohl es nichts in der Natur gibt, das ein mathematisches Prinzip mit mathematischer Genauigkeit verkörpert. Allfällige Genauigkeiten werden lediglich durch Modellvorstellungen angenähert, die alleine im menschlichen Geiste existieren. In Hinsicht auf die Mathematik ist auch die exakteste Naturerscheinung eine mehr oder weniger grobe Näherung. Die Abweichungen von den mathematischen Forderungen sind meist beträchtlich. Die mathematischen Beschreibungen können als Ideen der Naturerscheinungen im PLATONschen Sinne angesehen werden.
Wird die Mathematik nach der Richtung ihres Ursprungs hin betrachtet, so ist sie den Geisteswissenschaften zuzuordnen. Steht jedoch die Anwendung zur Beschreibung von Naturgesetzen im Vordergrund, so ist man geneigt, ihr bei den Naturwissenschaften einen Platz einzuräumen. Und zwar als nützlicher Nachbar der exakten Naturwissenschaften. Es kommt dadurch zum Ausdruck, was im Zusammenhang mit den Naturwissenschaften unter dem Begriff «exakt» zu verstehen ist. Exakt heisst hier berechenbar. Führte man das Wort auf das lateinische «exactus» zurück, so würde der Begriff «genau zugewogen, wohlerwogen» bedeuten. Dies aber sind Prädikate, auf die zu verzichten sich keine Wissenschaft leisten kann. Mit dem « Exakt» der exakten Naturwissenschaften soll die Berechenbarkeit betont werden.
Als ein Beispiel der Zuordnung der Mathematik sei erwähnt, dass diese an der Universität Basel seit der Trennung der philosophischen in eine philosophisch-historische und eine philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät in den Rahmen der Naturwissenschaften gestellt ist. Was die grossen Basler Mathematiker dazu sagen, können wir nicht hören.
Bei der Philosophie scheint die Zugehörigkeit eindeutiger zu sein. Wo anders als im Schoss der Geisteswissenschaften sollte sie ihren Platz haben. Ja, wir sind bereit, die Philosophie als Mutter der Wissenschaften zu anerkennen. Denn von allen Wissenschaften spinnen sich Fäden zu dem, was wir philosophieren nennen. Philosophieren ist geistige Auseinandersetzung mit der Welt und uns selbst. Diese Tätigkeit schuf die Substanz, aus welcher das Gebäude der Philosophie besteht. Alle Wissenschaften haben Beziehung zur Philosophie. Auch diejenigen, wo bei der Ausübung wissenschaftlicher Tätigkeit nicht mehr philosophiert wird, sondern ganz einfach Methoden angewendet werden.
Die letztere Aussage kann als eine Behauptung bezeichnet werden. Sie wirft die Frage auf, ob es möglich ist, wissenschaftliche Arbeit zu leisten ohne zu philosophieren. Diese Frage wird von denjenigen Philosophen bejaht, die der Ansicht sind, dass die Philosophie keine Wissenschaft sei. Da diese Philosophen kaum bescheidener sind als diejenigen, die von ihnen als Wissenschaftler bezeichnet werden, ist anzunehmen, dass sie mit dieser Feststellung den Rang der Philosophie nicht etwa erniedrigen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Mutter der Wissenschaften soll über ihren Kindern stehen.
Andere Philosophen betrachten die Philosophie als eine Wissenschaft. Die Streitfrage lautet hier also nicht: zu welchen Wissenschaften gehört die Philosophie? Vielmehr besteht die Alternative: ist die Philosophie eine Wissenschaft oder nicht? Wenn ja, so ist sie zweifellos in den Rahmen der Geisteswissenschaften zu stellen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass der in der angelsächsischen Welt verwendete Ausdruck « Natural Philosophy» mit «Naturwissenschaften» zu übersetzen ist. In vielen Fällen des Sprachgebrauches sogar mit «exakten Naturwissenschaften».
Was veranlasst die Philosophen, die Frage zu stellen, ob die Philosophie eine Wissenschaft sei oder nicht? Wie wir gesehen haben, ist das vom Geiste getragene Denken im Bereich der Wissenschaften durch die Methode geprägt. Im gleichen Masse, wie sich die Wissenschaften unterscheiden, unterscheiden sich auch ihre Methoden. Die verschiedenen Methoden sind jeweils dem in Betracht gezogenen Gebiet angepasst. Oder es könnte auch gesagt werden, dass sich ein wissenschaftliches Gebiet unter der Anwendung der Methode bildet. Jede Methode erfordert eine Einschränkung des Denkens auf das in Betracht gezogene Gebiet. Diese Einschränkung kann geradezu als ein Teil der wissenschaftlichen Methode bezeichnet werden. Eine solche Einschränkung möchte sich die Philosophie aber nicht auferlegen. Vielmehr möchte sie ein Denken erfassen, das nur auf der Ganzheit des Geistes zu wachsen vermag. Also auch das Denken, das an keine Methode gebunden ist. Und das meiste, das gedacht wird, steht ausserhalb des Zwangs einer Methode. Zum Beispiel das Denken im täglichen Leben. Damit ist nicht nur das Denken des sogenannten kleinen Mannes gemeint. Auch der Intellektuellste denkt im täglichen Leben sehr oft ohne Methode. Denn ausgerechnet bei den Dingen, die uns am nächsten stehen, versagt das wissenschaftliche Denken. Trotzdem sind aus unmethodischem Denken viel, sogar sehr viele Gedanken entsprungen, die zum Grundstein einer Wissenschaft wurden. Die Geschichte der Wissenschaft ist voll von solchen Beispielen. In diesem, hinsichtlich des Denkens umfassenden Sinne möchte sich die Philosophie als Mutter der Wissenschaften sehen. Sie will sowohl das wissenschaftliche als auch das unwissenschaftliche Denken in sich aufnehmen. Das Denken der Philosophie soll frei vom Zwang und den Einschränkungen der Methoden sein. Das will natürlich nicht heissen, dass in der Philosophie die Anwendung einer Methode ausgeschlossen sein soll. In solcher Bemühung will ein Teil der Philosophen die Philosophie ausserhalb der Wissenschaften stellen. Das heisst, nach der Ansicht dieser Philosophen sollen sowohl die intuitiven als auch die deduktiv-induktiven Kräfte des Geistes Mittel und Gegenstand der Philosophie sein.
Die Philosophen, die die Philosophie als eine Wissenschaft sehen, müssen das unwissenschaftliche Denken aus der Philosophie ausschliessen. Unwissenschaftliches Denken aber bringt den grössten Teil alles Gedachten hervor. Dessen müssen wir uns klar sein. Eine Philosophie, die nur das von Methoden geprägte Denken zulässt, verschliesst sich wesentlichen Teilen des menschlichen Geistes und Seins. Somit werden von einer Philosophie, die darauf verzichtet, eine Wissenschaft zu sein, viel grössere Geistesräume umspannt. Wie schon gesagt, ist die treibende Kraft solchen Verzichtes nicht Bescheidenheit, sondern der Wille, alle Kräfte des Geistes zu umfassen. Das Spektrum der von wissenschaftlichen Einschränkungen befreiten Philosophie reicht von den freien Künsten bis zur Experimentalphysik. Eine solche Auseinandersetzung mit unserem Dasein, die auch die Künste mit einschliessen will, kann nicht als Wissenschaft bezeichnet werden. Die Philosophen, die sagen, die Philosophie sei keine Wissenschaft, wollen damit zum Ausdruck bringen, dass im Pflichtenheft der Philoso-
phie nicht nur die Wissenschaften aufgeführt sind. Die Frage, ob ein solches Pflichtenheft überladen ist, steht auf einem anderen Blatt. Doch wenn die Philosophie Mutter alles geistigen Schaffens sein soll, so kann sie keine Wissenschaft sein. Denn die freien Künste sind mit wissenschaftlichen Methoden nicht fassbar. Kunst ist immer ein unmittelbarer Ausdruck menschlichen Seins. Wissenschaft ist immer mittelbar.
So könnte gesagt werden, eine Philosophie, die sich auf die wissenschaftlichen Betrachtungsweisen beschränkt, ist selbst eine Wissenschaft. Will sie sich jedoch von solchen Schranken befreien, so kann sie nicht mehr als Wissenschaft bezeichnet werden. Eine solche Philosophie umfasst mehr als die Wissenschaften. Dabei ist das «mehr» nicht als Werturteil zu verstehen. Welche Philosophie, die umfassende oder die wissenschaftliche, vertreten werden soll oder kann, ist eine offene Frage. An dieser Stelle möchte ich lediglich in Erinnerung rufen, dass es eine historische Tatsache ist, dass jede Epoche geneigt war, ihre Kräfte zu überschätzen. Nicht selten hat eine solche Überschätzung zum Untergang geführt. Unsere Epoche wird immer wieder als Zeitalter der Wissenschaft und Technik bezeichnet.
So offen die Frage nach der Einordnung von Mathematik und Philosophie in das Gebäude der Wissenschaft bleibt, so eindeutig wird den Naturwissenschaften ein Platz zugewiesen. Der Name ist sprechend. Er bringt zum Ausdruck, dass die Natur mit wissenschaftlichen Methoden betrachtet wird. Mit Natur bezeichnen wir alles, was von unseren Sinnen direkt oder mittelbar wahrgenommen werden kann. Zu den mittelbaren Wahrnehmungen gehören alle Anzeigen von Detektionsverfahren, welche Vorgänge und Zustände, die unseren Sinnen nicht direkt zugänglich sind, in sinnlich wahrnehmbare Eindrücke verwandeln. Als ein Beispiel könnte die Magnetnadel genannt werden, welche uns das Vorhandensein und die Richtung von Magnetfeldern anzeigt. Über ein Sinnesorgan, das magnetische Felder wahrzunehmen vermag, verfügen wir nicht. Doch gibt es auch viele Fälle, wo, obwohl ein direkter Sinneseindruck möglich wäre, einer mittelbaren Wahrnehmung der Vorzug gegeben wird. So wird es allgemein vorgezogen, die mögliche Giftigkeit eines Stoffes mit einer chemischen Analyse und nicht mit allfälligen, durch den Genuss des Stoffes hervorgerufenen Sinnesempfindungen zu prüfen.
Wir wollen an dieser Stelle festhalten, dass die Realität unseres Daseins nicht aus den Sinneswahrnehmungen allein besteht. Vielmehr gibt es eine grosse Zahl von Realitäten, zu deren Wahrnehmung uns kein Sinn zur Verfügung steht. Dazu gehört zum Beispiel unser Gefühlsleben, das so wirklich ist wie Feuer und Wasser. Gefühle nehmen wir ohne Sinnesorgane wahr. Oder dasjenige, auf dem alle wissenschaftliche Tätigkeit gebaut ist. Das Denken! Auch das Denken in uns nehmen wir ohne Sinnesorgan wahr. Was wir mit den Sinnen wahrnehmen können, sind lediglich die Ausdrucksformen des Denkens. Dazu gehören die Sprache, die Schrift und die bildnerische Darstellung. Gerade weil wir das Denken nicht mit einem Sinn unmittelbar wahrnehmen können, sind die Ausdrucksgebungen wesentlich. Auch der grösste Denker bleibt unerkannt, wenn er seinen Gedanken nicht eine Ausdrucksform zu geben vermag. Die Ausdrucksform ist daher ebensowichtig wie die Gedanken selbst. So würde sich beispielsweise KANT eines grösseren und vor allen Dingen freiwilligeren Leserkreises erfreuen, wenn seine Sprache nicht so knorrig wäre.
Bei der Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf die verschiedenen, in der Natur vorzufindenden Phänomene entstand eine schismaartige Situation. Es erwies sich nämlich, dass in der Natur Gegebenheiten und Vorgänge zu finden sind, welche unter Zugrundelegung einer mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise einer wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich sind. Unter dem Aspekt einer solchen Bearbeitung trennten sich Phänomene ab, die sich einer mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise verschliessen. Zu diesen Phänomenen gehört alles, was wir Leben nennen. So schied sich unter den Werkzeugen der Naturwissenschaftler die Natur in Lebendiges und Nichtlebendiges. Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass ein solches Schisma nicht in der Natur selbst vorliegt, sondern erst durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf die Natur entstanden ist.
Je länger und intensiver die Erscheinungen der Natur mit den Methoden der Naturwissenschaften bearbeitet werden, um so schärfer zeichnet sich diese Spaltung ab. Ein historischer Rückblick macht dies deutlich : Noch im 18. Jahrhundert war der 1700 in Groningen geborene Sohn DANIEL des JAKOB [korrigiert von M. T.: JOHANN] BERNOULLI an der Universität Basel Professor für Anatomie, Botanik und Physik. Eine solche Universalität wäre heute undenkbar. Die Naturwissenschaften sind in zwei Gruppen gespalten. Die Gruppe, welche unter der Anwendung der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise arbeitet, erhielt die Bezeichnung «exakte Naturwissenschaften». Die andere Gruppe hat sich zu ihrer Benennung kein Epitheton zugelegt. Der Name lautet ganz einfach « Naturwissenschaften». Dies lässt mehr Freiheit erwarten. Dem ist auch so. Denn die exakten Naturwissenschaften sind in ihrer Ausübung an das gebunden, was in ihrem Zusammenhang unter exakt verstanden wird.
Die Naturwissenschaften, die nicht zu den exakten gezählt werden, befassen sich mit dem Phänomen Leben. Man könnte dieser Gruppe daher mit gutem Grund den Namen Biologie geben. Somit könnten die beiden Gruppen der Naturwissenschaften mit « Biologie» und « Exakte Naturwissenschaften» bezeichnet werden. Im Sinne einer Gegenüberstellung ist eine solche Namensgebung nicht üblich, aber durchaus richtig. Denn aus der Sicht der Naturwissenschaften scheint uns die Natur in zwei Teile gespalten: in das Lebendige und das Nichtlebendige. Noch einmal sei betont, diese Aufspaltung liegt nicht in der Natur selbst vor, sondern entstand durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf die Natur. Die Natur als solche ist ein geschlossenes Ganzes. Abgetrennte Teile der Natur gibt es nur in unserer Vorstellung. In der Wirklichkeit ist alles mit allem auf das innigste verwoben. Nichts ist unabhängig. Gegenüber dem Phänomen Leben erweisen sich die Methoden der exakten Naturwissenschaften als inadäquat. Diese Tatsache deutlich aufzuzeigen, soll mitunter eine Aufgabe unserer Kritik sein.
Um die Aufteilung in die beiden Gruppen der Naturwissenschaften zu verdeutlichen, sollen deren grundlegende Fächer genannt werden:
Zur Biologie gehören die Anthropologie, die wissenschaftlichen Aspekte der Medizin, die Zoologie und die Botanik. Diese Einteilung bringt deutlich zum Ausdruck, dass die Biologie das Phänomen Leben in die Bereiche des menschlichen, tierischen und pflanzlichen Daseins aufteilt. Auch hier müssen wir uns wiederum im klaren sein, dass eine solche Einteilung eine Folge wissenschaftlicher Betrachtungsweise und nicht eine Gegebenheit der Natur ist. Das Leben ist eine in sich geschlossene Ganzheit, in welcher die Leben als Individuen auftreten. Die Wahrnehmung der Ganzheit erzeugt den Eindruck einer schillernden, verwirrenden Vielfalt, die für eine wissenschaftliche Betrachtungsweise geradezu eine Herausforderung darstellt. So bestand am Anfang der Wissenschaften die Arbeit der Biologen zu einem grossen Teil aus dem Aufbau einer Systematik, welche die Individuen nach einem für richtig befundenen Ordnungsprinzip in Gattungen einteilt.
Die grundlegenden Fächer der exakten Naturwissenschaften sind die Astronomie, die Physik, die Chemie, die Mineralogie und die Geologie. Wie wir gesehen haben, ist die Zuordnung der Mathematik umstritten.
Nun drängt sich die Frage auf, worin die Methoden bestehen, die dazu geführt haben, dass sich aus der ursprünglichen Ganzheit naturwissenschaftlicher Betrachtung die exakten Naturwissenschaften losgelöst haben. Oder anders gefragt: was hat dazu geführt, dass heute Lebendiges und Nichtlebendiges im Rahmen naturwissenschaftlicher Tätigkeit als voneinander getrennte Bereiche auftreten? Nirgends ist bei wissenschaftlichen Betrachtungen eine so unerbittliche Grenze zu finden wie zwischen Lebendigem und Nichtlebendigem unter dem Aspekt der exakten Naturwissenschaften. Die Ursache besteht in einer Methodentrilogie.
Erstens: Betrachtung der Natur unter der Matrix einer mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise.
Zweitens: Die Durchführung von Experimenten unter dem Gesichtspunkt der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise. Mechanistische Prinzipien fordern die Bedingung, dass ein Experiment nur dann wissenschaftlichen Wert hat, wenn es in jedem entsprechend eingerichteten Laboratorium reproduzierbar ist.
Drittens: Die quantitative Darstellung und Auswertung der mechanistischen Betrachtungsweise und der Experimente mit Hilfe des differentiell-kausalen Prinzips.
Aus dieser Methodentrilogie besteht das Fundament der exakten Naturwissenschaften. Das nächste Kapitel ist der Diskussion dieser Methoden gewidmet, die, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, sich nicht dazu eignen, das Wesen des Lebendigen zu erfassen. Aus diesem Grunde können mit Lebewesen keine im Sinne der exakten Naturwissenschaften reproduzierbaren Experimente angestellt werden. Eine quantitative Erfassung des Lebendigen durch das differentiell-kausale Prinzip ist daher ausgeschlossen. Mit ihrer fundamentalen Methodentrilogie haben sich die exakten Naturwissenschaften in einen Bereich gestellt, der sich ausserhalb alles Lebendigen befindet.
Die Natur ist eine geschlossene Ganzheit. Der Begriff des Teils im Sinne einer Abtrennung existiert in ihr nicht. Alle Teile der Natur beziehen sich immer auf deren Ganzheit. Die Aufspaltung der Naturwissenschaften in Teilgebiete widerspricht daher dem ganzheitlichen Wesen der Natur. Und zwar wächst dieser Widerspruch mit dem Rückgang der Beziehungen zwischen den einzelnen Wissensgebieten. Wie wir gesehen haben, ist der Zerfall in Spezialgebiete eine Folge der wissenschaftlichen Betrachtungsweise überhaupt. Angesichts der geschlossenen Ganzheit der Natur wird heute in zunehmendem Masse versucht, die verschiedenen Gebiete der Naturwissenschaften auf einen Nenner zu bringen. Doch ist das Verfahren dieses Gleichnamigmachens einseitig. Der Weg, der zu einer Renaissance naturwissenschaftlicher Universitas führen soll, ist ausgesprochen einsinnig orientiert. Er ist gewissermassen eine Einbahnstrasse oder ein Monodrom, wie der automobilistische Begriff in Hellas' Städten mit nahezu wissenschaftlichem Klang heisst. Denn die Bemühungen zu einer umfassenden naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise bestehen darin, dass versucht wird, das Phänomen Leben auf physikalisch-chemische Gesetze zurückzuführen. Dieses Vorgehen wird durch die Tatsache angeregt, dass in den Organismen chemische und physikalische Prozesse und Zustände angetroffen werden können. Jedoch ist das Wesentliche des Lebens, nämlich die werdende, seiende und vergehende Gestalt, nicht einmal in ihren geringsten Teilen mit den Gesetzen der exakten Naturwissenschaften erfassbar. So handelt es sich bei der Ansicht, das Leben sei eine ausgeklügelte, wechselwirkende Summe von Nichtlebendigem, um eine reine Hypothese. Bis zum heutigen Tag konnte in der Natur nichts gefunden werden, das auch nur ahnungsweise auf die Richtigkeit dieser Hypothese hinweist. Wieder einmal mehr ist auch hier der Wunsch Vater des Gedankens. Trotzdem wird in den biologisch orientierten Gebieten der exakten Naturwissenschaften so getan und gearbeitet, als ob diese Hypothese eine Tatsache wäre.
An das Umgekehrte, nämlich an die Möglichkeit, dass Nichtlebendiges von den gestaltenden Kräften des Lebendigen durchdrungen sein könnte, wird kaum gedacht. Für die meisten Wissenschaftler riecht ein solcher Gedanke nach Metaphysik. Die Wiedervereinigung der Naturwissenschaften soll in imperialer Weise zugunsten der exakten Naturwissenschaften geschehen. Warum wohl? Wegen der Erfolge der Technik. Jede wissenschaftliche Beschäftigung mit der dem Lebendigen innewohnenden Ganzheit führt auf eine morphologische Betrachtungsweise, welche schauend die Erscheinungsformen des Lebens zu erfassen versucht. Im Gegensatz zu den differentiellkausalen Methoden der exakten Naturwissenschaften ist es der Morphologie nicht gegeben, die Gegenstände ihrer Betrachtung in den Griff zu bekommen. Durch die auf den exakt-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen bauenden Erfolge der Technik hat der Mensch als Homo faber Geschmack daran gefunden, die Dinge in den Griff der differentiell-kausalen Werkzeuge zu bekommen. Um der von Menschen hervorgebrachten Maschinen willen wird daher das erzeugende Erkennen der exakten Naturwissenschaften höher gewertet als das schauende Erkennen der morphologischen Betrachtungsweise. Für die technokratische Gesellschaft bedeutet es ein Hindernis, dass mit dem differentiell-kausalen Werkzeug nur die nichtlebendigen Teile der Natur bearbeitet werden können. Daher wird versucht, durch Anwendung exakt-naturwissenschaftlicher Methoden auf das Lebendige auch das Leben in den Griff der Technik zu bekommen. Bis jetzt war bei diesen Versuchen das Leben immer dasjenige, das beim Ansetzen des differentiell-kausalen Werkzeuges entschwand.
Aus dieser Sicht gesehen ist das heute versuchte Mittel, das zu einer Einheit der Naturwissenschaften führen soll, nicht ein bilaterales Gespräch zwischen der Biologie und den exakten Naturwissenschaften, sondern eine Eroberung der Biologie durch die exakten Naturwissenschaften. Wie die Geschichte lehrt, hatten Eroberungen immer Rückschläge zur Folge. Doch die modernen Naturwissenschaftler belasten sich nicht I mit Geschichte, wo es ihnen schon genügend Mühe macht, dem zu folgen, was sie Fortschritt nennen.
Die Methoden der exakten Naturwissenschaften
Das Wesen der exakten Naturwissenschaften besteht in einer Trilogie von Methoden, die zum Zwecke der Erforschung der Natur systematisch auf die Natur angewendet werden. Die Methoden sind:
1. Die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise
2. Das systematisch-reproduzierbare Experiment
3. Das differentiell-kausale Prinzip
An erster Stelle steht die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise, der immer eine Maschine zugrunde liegt. Dabei ist unwesentlich, ob die Maschine wirklich existiert oder nur gedacht ist. Die verschiedenen Atommodelle zum Beispiel sind gedachte Maschinen. Eine Maschine besteht immer aus einer nach formallogischen Prinzipien ablaufenden Konstruktion.
Im systematisch-reproduzierbaren Experiment werden die der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise zugrunde gelegten Maschinen im Laboratorium verwirklicht, in ihrem Zustand und Ablauf unter Ausschaltung von störenden Faktoren beobachtet und ausgemessen. Dabei sei eine wesentliche Tatsache festgestellt: zu den störenden Faktoren gehört auch der Experimentator, also der Mensch.
Das differentiell-kausale Prinzip ermöglicht einerseits eine quantitative Erfassung von mechanistisch-deterministischen Betrachtungen und experimentellen Beobachtungen unter Zuhilfenahme von mathematischen Werkzeugen. Andererseits erlaubt die dem differentiell-kausalen Prinzip zugrunde gelegte Mathematik das Auffinden von mechanistisch-deterministischen Betrachtungen, die einer direkten Anschauung nicht zugänglich sind. Als ein Beispiel dafür sei die Relativitätstheorie genannt.
Hinsichtlich des exakt-naturwissenschaftlichen Experimentes ist eine Tatsache hervorzuheben, deren Bedeutung meist wenig Beachtung geschenkt wird. Es ist dies der prinzipielle Unterschied zwischen einem physikalischen und einem chemischen Experiment. Obwohl beide, Chemie und Physik, in den Bereich der exakten Naturwissenschaften gehören, besteht zwischen einem chemischen und einem physikalischen Experiment nicht nur ein gradueller, sondern ein prinzipieller Unterschied. Das physikalische Experiment ist nämlich auf die Erfassung stofflicher Zustände und Abläufe mit Hilfe von Quantitäten ausgerichtet. Dazu erscheint das chemische Experiment, das versucht, die stofflichen Erscheinungen mit Hilfe von Qualitäten, sogenannten chemischen Eigenschaften, zu fassen, als ein Gegenpol. In der Konsequenz hat dieser Sachverhalt zur Folge, dass zwischen der Chemie und der Physik nicht bloss ein gradueller, sondern ein prinzipieller Unterschied besteht. Dies kann getrost zur Beruhigung jener Chemiker gesagt werden, die, von den schillernden Werkzeugen der Physik allzu stark beeindruckt, fürchten, dass ihr Beruf dereinst durch die Entwicklung der Physik überflüssig werde. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass die Spaltung der Atomkerne des Uranisotops 235 durch langsame Neutronen von OTTO HAHN und FRITZ STRASSMANN mit chemischen Methoden entdeckt wurde. Das für die Menschheit so schicksalsschwangere Atomzeitalter wurde also nicht von Physikern, sondern von Chemikern begründet. Die damals, im Jahre 1939, zur Verfügung stehenden physikalischen Methoden hätten nicht ausgereicht, um die Uranspaltung festzustellen.
Die chemischen Eigenschaften der Stoffe können, wie alle Qualitäten, mit Mechanismen weder beschrieben noch verstanden werden. Dazu wäre die Existenz von Gestaltsatomen erforderlich. Solche Atome sind aber nicht denkbar, da jede Atomvorstellung auf Mechanismen beruht und die Qualitätsgestalt der Stoffe mit Mechanismen nicht erkennbar ist. Da wir nur das erkennen können, was wir selbst hervorbringen, sind im Bereich der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise ausschliesslich Mechanismen erkennbar. Somit ist es ausgeschlossen, mit Hilfe der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise Stoffqualitäten zu erkennen, da diese mit Mechanismen nicht beschreibbar sind. Daher unterscheidet sich das chemische Experiment wesentlich vom physikalischen, welch letzteres immer auf die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise zurückführt. Wahrscheinlichkeitsräumen, Unbestimmtheitsrelationen und Probabilitätsbetrachtungen zum Trotz steht dieses Prinzip am Anfang und Ende jeglicher physikalischer Tätigkeit.
Da die Chemie zur Hauptsache die Qualitäten und nicht die Quantitäten der stofflichen Welt betrachtet, erscheint in der Trilogie der exakt-naturwissenschaftlichen Methoden das Experiment als ein in Chemie und Physik aufgespaltenes Dublett. Diese Tatsache soll bei der Besprechung des Experiments zum Ausdruck gebracht werden.
Die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise
So wie es die Physik, die Chemie, die Biologie, das heisst die Wissenschaften überhaupt, in der Natur nicht gibt, ist die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise als Methode der exakten Naturwissenschaften in der Welt, in der wir leben, nirgends zu finden.
Die Wissenschaften mit ihren Methoden existieren nur in dem vom Geist getragenen Denken des Menschen und nicht in der Natur selbst. Daran sei erinnert, da diese als Binsenwahrheit anmutende Tatsache von allzu beschäftigten Naturforschern aus Zeitmangel gerne vergessen wird. So wie man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen kann, ist es möglich, dass im Laboratorium das Wesen der Natur zwischen Apparaten und Formeln in einem Masse verkannt wird, das einem in mancher Hinsicht folgeschweren Irrtum Tür und Tor zu öffnen vermag. Dieser Irrtum besteht in der Identifizierung von Natur und Naturwissenschaft. Daraus kann ein noch schlimmerer Irrtum entstehen. Nämlich, dass sich die Naturwissenschaftler als Gesetzgeber der Natur betrachten.
Die Natur ist eine Gegebenheit der Schöpfung. Die Naturwissenschaften mit ihren Methoden sind ein Produkt des menschlichen Denkens. Was die Naturgesetze anbetrifft, ist zu sagen, dass die Natur an keine von jenen Zuständen, Verhalten oder Abläufen gebunden ist, die von der Wissenschaft in den Rang eines Naturgesetzes erhoben wurden Die Natur ist nicht an die von uns gefundenen Gesetze gebunden. Eine Tatsache, an die wir beim Wunsch, die Natur in den Griff zu bekommen, nicht gerne denken. Es wäre heutzutage, wo mit Zeiträumen von der Grössenordnung Millionen oder gar Milliarden Jahre in die Vergangenheit und auch Zukunft extrapoliert wird, unwissenschaftlich, wenn eine solche Gebundenheit auf Grund der täglichen Erfahrung und ein paar Jahrhunderten Geschichte postuliert würde. Aber Häuser werden immer so gebaut, als ob es keine Erdbeben gäbe.
Die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise begegnet uns heute auf Schritt und Tritt in Form von Maschinen verschiedenster Arten. - Noch vor hundert Jahren war dies in keiner Weise der Fall. Auch in den grossen Städten Europas und Amerikas musste man damals bis zur nächsten Maschine manche Schritte gehen. - Was sind Maschinen? Wirkliche oder gedachte, auf jeden Fall von Menschen gebaute Vorrichtungen, die imstande sind, Vorgänge in einem vorausbestimmten Sinne ablaufen zu lassen. Maschinen sind, wie die mechanistisch-deterministische Betrachtungsweise vom Menschen hervorgebracht und können daher vom Menschen verstanden werden. Der Ablauf einer Maschine ist immer mechanistisch-deterministisch, da er auf Grund der Konstruktionselemente und deren Koppelung bestimmt werden kann. Eine Maschine kann immer in ihre Einzelteile zerlegt und der Konstruktionsvorschrift entsprechend wieder zusammengesetzt werden. Die Einzelteile haben eine ganz bestimmte Form und sind durch eine wohldefinierte Oberfläche scharf voneinander getrennt. Diese Selbstverständlichkeiten seien in Hinsicht auf die Betrachtung von Lebewesen betont.
Auch eine gedachte bzw. abstrakte Maschine muss die genannten Bedingungen erfüllen. Anders kann man sich eine Maschine gar nicht denken. Also, der Begriff «mechanistisch-deterministisch» ist streng mit dem Ablauf einer Maschine verknüpft. Es soll hervorgehoben werden, dass im strengen Sinne nur eine gedachte Maschine mechanistisch-deterministisch abläuft. Denn jeder wirklichen Maschine droht die Panne, was alles andere als ein deterministisches Geschehen darstellt. Auch ist die Konstruktion einer wirklichen Maschine auf rein mechanistisch-deterministischem Wege nicht möglich. Wenn dem so wäre, so bedürfte die Industrie nur des Reissbretts, des Schreibtischs und der Konstruktionswerkstätten. Die kostspieligen Entwicklungs- und Kontrollaboratorien könnte sie sich schenken. Die wirkliche Maschine bedarf der Erfahrung, die eben nicht errechnet, sondern nur erfahren werden kann. Die Etymologie des Wortes «erfahren» ist im vorliegenden Zusammenhang besonders interessant: es leitet sich aus dem althochdeutschen «irfaran» ab, das die Bedeutung von «reisen, durchfahren, durchziehen, erreichen» hatte. Erfahren bedeutet erleben, welches dasjenige voraussetzt, welches mit dem mechanistisch-deterministischen Prinzip nicht in den Griff zu bekommen ist: das Leben. Man kann die obengenannte Tatsache natürlich leugnen und behaupten, dass nicht nur die gedachten, sondern auch die wirklichen Maschinen ein streng mechanistisch-deterministisches Verhalten aufweisen. Die Pannen seien den Maschinen nicht prinzipiell, sondern höchstens im Bereich einer errechenbaren und beliebig klein zu haltenden Probabilität inhärent. Die Geschichte unseres Jahrhunderts lehrt, dass diese Vorstellung eine Zwangsvorstellung ist, die bei konsequenter Anwendung in den dialektischen Materialismus führt. Dort, wo diese Ideologie zur Staatsräson erhoben wurde, haben die Ingenieure für das Versagen der Theorie mit dem bezahlt, was die Maschine nicht hat: Leben. Ein streng mechanistisch-deterministisches Verhalten weist nur die gedachte, abstrahierte Maschine auf.
Obwohl oder gerade weil das Wort «verhalten» von vielen Autoren im Zusammenhang mit Maschinen gebraucht wird, möchte ich auf die dem Wort zugeordnete Bedeutung aufmerksam machen: Bei den Meistern der Feder verhalten sich Menschen, Tiere und Pflanzen; niemals aber Maschinen. Maschinen laufen ab. Zum Verhalten bedarf es dessen, was Lebewesen von Maschinen unterscheidet: der Innerlichkeit und der darauf beruhenden Beziehung zur Umwelt. «Verhalten» gehört dem reflektierenden Subjekt und «ablaufen» dem ausserhalb des Lebendigen stehenden Objekt. Die Betrachtung eines Lebewesens als Objekt bedeutet immer eine Vergewaltigung seiner Innerlichkeit. Lebewesen sind als die Leben immer Subjekte, welche als Gesamtheit aller Individuen das Leben bilden. Im Gegensatz dazu sind Maschinen immer Objekte, die nie eine Gesamtheit bilden. Es könnte gesagt werden, dass derjenige Teil der Lebewesen, welcher von den Objektiven optischer Instrumente abgebildet werden kann, mit einem Objekt vergleichbar ist. Aber die Objektive der optischen Instrumente vermögen etwas Wesentliches nicht zu fassen: die Innerlichkeit. Obwohl wir die Innerlichkeit nicht über ein Sinnesorgan, sondern auf unmittelbare Weise wahrnehmen, ist uns ihre Existenz nicht weniger offenbar als die sinnlich wahrnehmbaren Dinge der Welt. Innerlichkeit kann nur zwischen Subjekten, das heisst zwischen Lebewesen, wahrgenommen werden. Das Auge ist unser kostbarstes Sinnesorgan. Es ist sowohl Organ des Sehens als auch, wie ADOLF PORTMANN sagt, Organ des Gesehenwerdens. In seinem Blick bringt das Auge als Organ des Gesehenwerdens die Innerlichkeit zum Ausdruck. Mit den verschiedensten Mitteln versuchen die Künstler, den Blick des Auges als Organ des Gesehenwerdens darzustellen. Es ist interessant, zu sehen, wie oftmals andeutende Striche den Blick eines Auges besser zum Ausdruck bringen als eine vollendete Abbildung. Es ist sinnlos, die Existenz der Innerlichkeit bestreiten zu wollen. Denn ein solches Bestreiten ist nichts anderes als eine Äusserung dessen, das bestritten werden soll: eine Äusserung der Innerlichkeit.
Wir wollen also festhalten, dass alle mechanistisch-deterministischen Systeme gedachte bzw. abstrahierte Maschinen sind, deren Ablauf formallogisch zu verfolgen und - wenn die Zeit als physikalische Dimension betrachtet wird - vorauszusagen ist. Es soll an dieser Stelle schon hervorgehoben werden, dass die physikalische Dimension « Zeit» die Dauer des Seins nicht zu erfassen vermag. Es wird diese Tatsache heute, wo wir von vielen Uhren aller möglichen Arten umgeben sind, nur allzuoft übersehen oder vergessen. Diese Gegebenheit soll in einer späteren Betrachtung zur Darstellung gelangen. Auch soll schon jetzt darauf hingewiesen werden, dass die aus der Betrachtung grosser Individuen- oder Ereigniszahlen entstandene Probabilitätslogik oder die von der Quantenphysik her angeregte KomplementaritätslogikÄste eines Baumes sind, dessen Wurzeln tief in das mechanistisch-deterministische Denksystem hineinragen. Lebensvorgänge können, aber müssen nicht logisch erfassbaren Gesetzmässigkeiten gehorchen. Ein Teil des Phänomens Leben vermag sich jenseits von Logik irgend einer Art zu stellen. Und zwar ist das derjenige Teil des Lebewesens, der das Lebendige vom Nichtlebendigen unterscheidet. Oder mit anderen Worten: dasjenige am Lebendigen, das sterben muss, steht jenseits der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise. Nur der von der physikalischen Materie getragene Teil des Phänomens Leben ist exakt-naturwissenschaftlichen Betrachtungen zugänglich.
Das dem mechanistisch-deterministischen System zugrunde gelegte Denken kann den Bau von wirklichen, laufenden Maschinen ganz gewaltig unterstützen. Dabei kann das Verhältnis zwischen reflektiver und intuitiver Denkarbeit und manueller Handlung die verschiedensten Werte annehmen. Wenn auch heute beim Bau von Maschinen das intellektuelle Moment immer mehr überwiegt, darf nicht vergessen werden, dass das meiste dieses Wissens seinen Ursprung in den Bastelerfindungen des 18. und 19. Jahrhunderts hat. War doch das grösste technische Erfindergenie jener Epoche, THOMAS ALVA EDISON, der Mathematik abhold. Es soll damit auf die Bedeutung der Hände des Menschen hingewiesen werden. Nicht zuletzt sind es auch die Hände, die den Menschen vom Tier unterscheiden. Es waren die vom Geiste gelenkten Hände, welche als von Gott gegebene Werkzeuge die Maschinen aus dem Schoss der Erde gehoben haben. Als Epimetheus betrachtet der Mensch das empirisch Geschaffene, und in seinem Kopf entsteht das mechanistisch-deterministische System als eine Abstraktion der Maschine, frei von allem Unvorhersehbaren der Welt, in der wir leben. Die Welt, in der wir werden, sind und sterben, ist etwas ganz anderes als eine Maschine. Das Unvorhersehbare erscheint im mechanistischen System als eine Art Tücke des Objektes. In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht um Tücken, sondern um Hinweise dafür, dass die Theorie den wirklichen Ablauf der Dinge nicht zu erfassen vermag.
Die abstrahierten Maschinen sind als mechanistisch-deterministische Systeme in ihrem Zustand und Ablauf formallogisch versteh- und verfolgbar. Höhere Mathematik ist für das Verstehen der mechanistisch-deterministischen Systeme nicht erforderlich, da dieses, wie eben gesagt, formallogisch möglich ist. Die vier Fundamentalsätze der Formallogik lauten:
Satz der Identität
Satz des Widerspruchs
Satz des ausgeschlossenen Dritten
Satz des hinreichenden Grundes
Die höhere Mathematik wird erst dann unentbehrlich, wenn nach der Dimensionierung, das heisst nach dem «Wieviel» bei den Bauteilen und dem Ganzen des Maschinenprinzips gefragt wird. Es ist dies eine wesentliche Tatsache. Denn eine mechanistische Betrachtungsweise der Natur, die oft und unvorsichtig in den Rang eines Weltbildes erhoben wird, ist nichts anderes als eine abstrahierte Maschine, die der Natur aufs Antlitz gepresst wird. Das Grundsätzliche solcher physikalischen «Weltbilder» ist auch dann einer philosophischen Kritik zugänglich, wenn der betreffende Philosoph mit der höheren Mathematik nicht vertraut ist. Allerdings kommt ein Philosoph, der die Tätigkeit der Naturwissenschaften und Technik kritisch beleuchten will, nicht um die Mühe herum, sich wenigstens grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und Technik anzueignen. Eine historisch-philologische Bildung allein würde also nicht genügen.
Es sind ausschliesslich die quantitativ fassbaren Probleme der Naturwissenschaften und Technik, zu deren Diskussion es des mathematischen Werkzeuges bedarf. Denken ist nicht nur Mathematik. Mathematik ist bloss eine der vielen Kategorien, die das Denken zu umfassen vermag. Dies soll auch in Hinsicht auf die Frage, ob ein sogenannter Computer denken könne, ausgesprochen und betont sein. Es ist daher sowohl eine falsche Einschätzung der Mathematik als auch eine Überheblichkeit, wenn allzu überzeugte Physiker behaupten, dass Philosophieren heutzutage nur noch sinnvoll sei, wenn der Philosoph sich in der Lage befinde, Differentialgleichungen zu lösen.
Ein einfaches Beispiel soll diesen Sachverhalt erläutern. Betrachten wir eine für unsere technische Zivilisation unentbehrliche Maschine: die Wärmekraftmaschine. Durch Abstraktion erhält man das der Maschine implizierte mechanistisch-deterministische System. Das heisst, die maschinelle Einrichtung, durch welche Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt wird, ist vorstellbar einzusehen. Das Grundprinzip einer jeden Wärmekraftmaschine, die Wärme direkt in mechanische Energie verwandelt, ist eine bewegte Wand, welche mit einem kompressiblen, wärmetragenden Arbeitsstoff in direktem Kontakt steht. Die ungeordnete Wärmebewegung der Moleküle des Arbeitsstoffes wird durch die bewegte Wand zu einem Teil gleichgerichtet. Der Anteil an gleichgerichteter molekularer kinetischer Energie entspricht der mit der Wärmekraftmaschine gewonnenen mechanischen Arbeit.
Sofort ändert sich die Situation, wenn die Frage nach dem prinzipiell möglichen Wirkungsgrad der Maschine gestellt wird. Es handelt sich beim Wirkungsgrad um das Verhältnis zwischen der zu gewinnenden mechanischen Energie und der zum Einsatz gebrachten Wärmemenge. Eine Beantwortung dieser quantitativen Fragestellung, die unter anderem zum fundamentalen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik geführt hat, ist nur durch die Anwendung mathematischer Werkzeuge möglich.
Es hat sich erwiesen, dass sich zur Bearbeitung von mechanistisch-deterministisehen Systemen das Differentialkalkül ganz besonders eignet. Die Differentialrechnung war und ist daher für die Entfaltung der exakten Naturwissenschaften von eminenter Bedeutung. Bald nach der Erfindung dieses mächtigen mathematischen Werkzeugs durch LEIBNIZ und NEWTON im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wurde die Differentialrechnung von den Brüdern JAKOB und JOHANN BERNOULLI in Hinsicht auf die Behandlung physikalischer Fragestellungen entwickelt. In der Folge hat sich durch die Anwendung der Differentialrechnung auf mechanistisch-deterministische Systeme, die, wie wir gesehen haben, immer Abstraktionen sind, das differentiellkausale Prinzip entwickelt. Im Bereiche der Anwendbarkeit dieses Prinzips, also bei mechanistischen Systemen, waren und sind reiche und durchschlagende Erfolge zu verzeichnen. Aus der Stille der Laboratorien haben diese Erfolge, durch technische Anwendungen offenbart, den Weg in die Welt gefunden. Wie auf anderen Gebieten wird auch hier der Erfolg als schlüssiger Beweis für die Richtigkeit, wenn nicht gar Wahrheit betrachtet. MAO TSE-TUNG schreibt in seiner Schrift «Woher kommen die richtigen Ideen der Menschen?»: «Allgemein gesagt ist richtig, was Erfolg bringt, und falsch, was misslingt. Das trifft besonders auf den Kampf der Menschheit mit der Natur zu. »
Durch die technischen Erfolge wurde die Anwendung der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise auf die Gegebenheiten der Natur zur Selbstverständlichkeit und Routine. Für die zweckbestimmte Anwendung ist die Routine sicher erforderlich. Der Könner bedient sich des Werkzeugs, ohne über die Struktur der zu bearbeitenden Substanz nachzudenken. Solange das Werkzeug auf die ihm entsprechende Substanz angewendet wird, ist dies im allgemeinen und auch in Hinsicht auf den Erfolg sicher richtig. Wird aber das Werkzeug auf eine neue Substanz angewendet, so sind Selbstverständlichkeit und Routine fehl am Platz. Denn die Selbstverständlichkeit ist nicht die Mutter des Denkens, das bei einer wissenschaftlichen Arbeit nie ausgeschlossen werden sollte. Rechnen und mathematische Betrachtungen allein sind noch nicht Denken. Immer sollte bei der Bearbeitung eines neuen Stoffes mit althergebrachten Werkzeugen das ganze Denkvermögen eingesetzt werden. Dies benötigt allerdings bedeutend mehr Zeit. Vielleicht hundert-, tausend- oder hunderttausendmal mehr Zeit als das unüberlegte, aber zu irgendeinem Ergebnis führende Ansetzen eines Werkzeugs. Die Folge eines solchen Vorgehens könnte zum Beispiel die Bearbeitung einer Gegebenheit mit ungeeigneten Mitteln sein. Dies müsste, da sind wir uns einig, zumindest als unwissenschaftlich bezeichnet werden. Zudem ist zu bedenken, dass sich die Folgen mancher Erfolge lange nach dem Eintreten des Erfolgs einstellen können. Es sei an das DDT erinnert.
Das naturwissenschaftliche Experiment
Der Geist des Menschen vermag durch der Sinne Fenster viele Gegebenheiten der Welt zu schauen. Aber die Welt des Menschen erscheint dabei nicht in ihrer Ganzheit, da das sinnlich Wahrnehmbare nicht alles ist. Doch sind die anderen Teile unserer Welt nicht weniger offenbar und wirklich. Wer wollte die Existenz von Gefühlen wie Liebe, Hass oder Begeisterung bestreiten, die wir in uns ohne Sinnesorgane oft deutlicher wahrnehmen, als was sichtbar vor unseren Augen liegt. Auch dasjenige, das sich im Geiste in der Bemühung um Erkenntnis reflektiert, das Denken, ist sinnlich nicht wahrnehmbar.
Das vom Geiste getragene Denken stösst in seiner Bemühung um exakt-naturwissenschaftliche Erkenntnis immer wieder an eine merkwürdige Grenze. Die Etymologie des Wortes «merkwürdig» ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da das Wort «merken» auf das germanische «Marka» zurückgeführt werden kann, das sowohl im Sinne von «Zeichen» als auch «Grenzzeichen» gesprochen wurde. Mark bedeutete Grenzland. Die Grenze, von der hier die Rede ist, liegt zwischen den Gegebenheiten der Natur und denjenigen Dingen, die der Mensch einerseits mit seinem Geiste in Form von Ideen (im Platonschen Sinne) und andererseits mit seinen vom Geiste gelenkten Händen als gestaltete Materie hervorzubringen vermag. Zwischen den Gegebenheiten der Natur und den vom Menschen hervorgebrachten Dingen besteht eine Zäsur, die dem exakt-naturwissenschaftlichen Erkennen Halt gebietet. Der Mensch vermag im Bereich der exakten Naturwissenschaften nur diejenigen Dinge zu erkennen, die er selbst hervorgebracht hat. Dem exakt-naturwissenschaftlichen Erkennen liegt ein «logos creativus» zugrunde, der, wie eben gesagt, selbst hervorbringen muss, was er erkennen will. Dies im Gegensatz zum Denken im klassischen Altertum, dem ein «logos theoretikos» zugrunde lag, der nicht ein schaffendes, sondern ein zweckfreies und schauendes Erkennen vermittelt. Die Gegebenheiten der Schöpfung liegen für das kreative, das heisst exakt-naturwissenschaftliche Erkenntnisvermögen jenseits. So vermag der Bildhauer nur die Gestalt, die er dem Stein gegeben hat, zu erkennen. Das Wesen des Vorbildes seines Werkes wie auch das Wesen des von ihm geformten Steins bleiben Geheimnis. Sicher besteht eine der treibenden Kräfte für das künstlerische Schaffen im Willen, durch selbst hervorgebrachte Gestalten Bereiche des Erkennens in die Welt zu setzen. MARC CHAGALL bringt dies zum Ausdruck, indem er sagt: «Das Land meiner Seele gehört ganz mir allein.»
Während Jahrtausenden haben die Künstler aller Kulturen mit ihren Werken Räume des menschlichen Erkennens geschaffen. Die freien Künste verschmelzen unsere Sinneseindrücke mit den Kräften des Geistes und der Seele zu erkennbaren Gestalten. Architektur, Bildhauerei und Malerei finden ihren Weg zu uns durch das in Raum und Zeit schauende Auge. In Musik und Poesie finden Geist und Seele einen Ausdruck, der sich unserer Innerlichkeit direkt zu offenbaren vermag und in Tanz und Schauspielkunst auch über die Sinne einen Weg zu uns findet. Aber es sind nicht die Sieben Freien Künste allein, mit welchen der Mensch die Natur mit Dingen durchsetzte, die als Produkte seines Geistes, seiner Seele und seiner Hände für ihn erkennbar sind.
Da sind die Philosophie und ihre nahe Verwandte, die Mathematik. Die Philosophie und Mathematik haben ihre Heimat im menschlichen Geist. Wenn bei den Künsten Geist und Seele abwechselnd einmal Geige und einmal Bogen sein können, so bemühen sich Philosophie und Mathematik, ihre Kräfte aus dem Geist allein zu schöpfen. Und zwar aus jenem Teil des Geistes, der im Spiegel der Ratio erscheint. So schuf die Philosophie eine sich mehrende und wandelnde Mannigfaltigkeit von Betrachtungen über die Gegebenheiten der Schöpfung. Die Mathematik erscheint gewissermassen als reinster Kristall der Ratio, durch welchen das Licht des menschlichen Geistes am schärfsten zu leuchten vermag. Die Euklidische Geometrie zeichnet einen Teil des mathematischen Denkens als Ideen von Formen und Gestalten der Welt, in der wir leben, in unserer Vorstellung ab. Aber der grösste Teil der Mathematik bleibt jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens. Dem mathematischen Denken ist es gegeben, ohne Anschauung mit beliebiger Schärfe und Präzision die Beziehungen und Abläufe der Quantitätsräume des Geistes zu erfassen.
So schuf der Mensch während der Jahrtausende seiner Kulturgeschichte mit den freien Künsten, der Philosophie und der Mathematik Dinge, die er, im Gegensatz zu den Gegebenheiten der Natur, als Geschöpfe seiner Tätigkeit zu erkennen vermag. Künste, Philisophie und Mathematik blieben bis in das Zeitalter der Renaissance und des beginnenden Barocks die Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber in jener Zeit begann sich in der Bemühung um Erkenntnis ein Mittel abzuzeichnen, das in allen vorausgegangenen Epochen unbekannt war. Namen wie LEONARDO DA VINCI, GALILEO GALILEI, EVANGELISTA TORRICELLI, RENE DESCARTES und BLAISE PASCAL erscheinen in jener Zeit, während welcher das neue Erkenntnismittel in die Wiege gelegt wurde, als Exponenten einer neuen Wissenschaftlichkeit. Das methodisch durchgeführte naturwissenschaftliche Experiment wurde in die Welt gesetzt! Dabei ist das Attributmethodisch» zu betonen. Denn es kann durchaus gesagt werden, dass Experimente mit mehr oder weniger Zufallscharakter im Rahmen der menschlichen Tätigkeit zu allen Zeiten durchgeführt wurden. Jedoch war LEONARDO DA VINCI einer der ersten, der unter Zugrundelegung einer wohldurchdachten Methode Dinge aus der zusammenhängenden Mannigfaltigkeit der Natur herausgegriffen und zu einer der Methode entsprechenden Anordnung zusammengestellt hat. Die Beobachtung des Zustands und Ablaufs einer solchen, auf dem Prinzip der zugrunde gelegten Methode konstruierten Anordnung aus Gegebenheiten der Welt, in der wir leben, ist der eigentliche Kern des methodisch durchgeführten naturwissenschaftlichen Experiments. Der Experimentator betrachtet gewissermassen von aussen her das Experiment. Das heisst, er ist bemüht, die Beobachtung unter Ausschluss jedes Einflusses seiner Person auf den Zustand und Ablauf der von ihm gebauten experimentellen Anordnung durchzuführen. Diese Trennung des menschlichen Subjekts vom Objekt des Experiments ist neben dem methodischen Vorgehen ein weiteres wichtiges Merkmal des modernen naturwissenschaftlichen Experiments. Denn ein Experiment soll vom Subjekt Mensch unabhängig, das heisst objektiv durchführbar sein. Diese Bedingung impliziert eine weitere Forderung: das Experiment muss unter den vorgeschriebenen Bedingungen unabhängig von der Person des Experimentators beliebig viele Male reproduziert werden können. Ein einmalig durchgeführtes Experiment, das in einem entsprechend eingerichteten Laboratorium nicht reproduziert werden kann, hat kein wissenschaftliches Gewicht.
Wie die Werke der Künste, der Philosophie und der Mathematik ist auch das naturwissenschaftliche Experiment keine Gegebenheit der Natur, sondern etwas, das der Mensch selbst hervorbringt und das daher dem «logos creativus» zugänglich ist. Der Naturwissenschaftler versucht mit dem Experiment gewissermassen die Natur, oder jedenfalls Teile davon, nachzuvollziehen, um sie dann durch das Mittel des Selbsthervorgebrachten zu erkennen. In logischer Konsequenz würde das heissen, dass der Mensch, wenn er die ganze Natur mit den Mitteln der exakten Naturwissenschaften erkennen wollte, in der Lage sein müsste, die ganze Natur selbst hervorzubringen.
Warum die exakt-naturwissenschaftliche Betrachtungsweise in der Geschichte der Menschheit erst relativ spät, das heisst vor etwa 450 Jahren, aufgetreten ist, stellt eine Frage der Geschichtsphilosophie dar. Auf diese bedeutungsvolle, mit dem Schicksal der Menschheit belastete Frage einzugehen, würde über den Rahmen der vorliegenden Betrachtungen hinausgehen. Jedoch soll darauf hingewiesen sein, dass die Frage mit Begriffen wie «Fortschritt» oder « Entwicklung» nicht abgetan werden kann. Seien wir und bewusst, eine solche Erklärung für die Entstehung der modernen Wissenschaften und der daraus entstandenen technisierten Welt würde fordern, dass 5500 Jahre der bekannten Geschichte der Menschheit weder Fortschritt noch Entwicklung gekannt hätten. Welche Überheblichkeit oder gar Selbstgefälligkeit würde eine solche Erklärung fordern! Alle Träger der grossen Kulturen müssten gegenüber uns als ignorant bezeichnet werden. So etwas ist ausgeschlossen. Der Grund für die geschichtliche Singularität, die das Auftauchen des methodischen naturwissenschaftlichen Experiments vor etwa 450 Jahren im grossen Zeitraum der Geschichte darstellt, muss ein anderer sein. Es soll in dieser Hinsicht auf die interessanten geschichtsphilosophischen Betrachtungen von KURT ROSSMANN hingewiesen sein.
Da es unser Anliegen ist, speziell die exakten Naturwissenschaften aus kritischer Sicht zu betrachten, soll das Wesen der exakt-naturwissenschaftlichen Experimente dargestellt werden. Der Vergleich mit dem auf einer morphologischen Betrachtungsweise beruhenden Forschen der Biologie, das das Reich des Lebendigen nicht konstruierend, sondern schauend zu erkennen versucht, vermag eine kritische Betrachtung durch die Wirkung von Kontrasten zu verdeutlichen. Eine Gegenüberstellung der mechanistisch-deterministischen und der morphologischen Betrachtungsweise weist auf die Verschiedenheit und auch Begrenztheit der Gebiete hin, die den beiden Forschungsmethoden zugänglich sind. Aber auch im Bereich der exakten Naturwissenschaften selbst sind zwei Methoden zu erkennen, die sich tiefgreifend voneinander unterscheiden: das physikaliche und das chemische Experiment.
Um den Unterschied zwischen dem quantitativ Fassenden des physikalischen und dem qualitativ Schauenden des chemischen Experiments klar aufzuzeichnen, sollen drei Epochen der exakten Naturwissenschaften vergleichend gegenübergestellt werden. Um zwei ihrer Epochen zu bezeichnen, haben die Naturwissenschaften die Begriffe «klassisch» und «modern» aus der Kulturgeschichte im Sinne einer Analogie entliehen. Für die vor der naturwissenschaftlichen Klassik liegenden Epoche existiert kein entsprechender Begriff. Wir könnten diesen Zeitraum in Anlehnung an den Begriff «Renaissance» als die «Naissance» der Naturwissenschaften bezeichnen. Denn es handelt sich nicht wie im Bereich der Künste und Kultur um eine Wiedergeburt, sondern um eine Epoche, in welcher die Naturwissenschaften in der Geschichte der Menschheit erstmalig geboren wurden. Es ist interessant, festzustellen, dass die «Naissance» der Naturwissenschaften in den Zeitraum der Renaissance fällt. Es ist dies kein Zufall. Denn die Wiedergeburt der griechischen Gedankenwelt im Schosse des biblisch-christlichen Kulturraums war eine der Voraussetzungen für die Geburt der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise.
Der Unterschied zwischen den quantitativen Konstruktionen physikalischer Betrachtungen und den Bemühungen der Chemie um eine Erfassung der stofflichen Qualitäten kommt in einer geschichtlichen Phasenverschiebung zum Ausdruck. Zu einer Zeit, wo die Physik bereits in der Lage war, ihre Quantitäten scharf zu umreissen, waren die Stoffqualitäten noch von alchimistischen Vorstellungen verhüllt. So wie die Renaissance auf Grund innerer Verschiedenheiten der Kulturräume eine räumlich-zeitliche Verschiebung von Süden nach Norden aufweist, besteht zwischen der «Naissance» von Physik und Chemie auf Grund von prinzipiellen Verschiedenheiten in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise eine beträchtliche zeitliche Verschiebung. Die prinzipiellen Verschiedenheiten in der Betrachtungsweise sind auf den Unterschied zwischen den der stofflichen Welt von uns zugeschriebenen Quantitäten und den den Stoffen inhärenten Qualitäten zurückzuführen. Wenn GALILEO GALILEI (1564-1642) als Vater der Physik und ANTOINE LAURENT LAVOISIER (1743-1794) als Vater der (modernen) Chemie bezeichnet werden, so beträgt diese Phasenverschiebung nahezu zweihundert Jahre. Dies ist in Anbetracht, dass die Geschichte der exakten Naturwissenschaften nicht viel mehr als vier Jahrhunderte zählt, eine bemerkenswerte Tatsache. Die Ursache dafür liegt, trotz immer wieder hörbaren Vermutungen, nicht darin, dass die Chemiker dümmer sind als die Physiker. Vielmehr ist diese geschichtliche Tatsache ein Hinweis für den prinzipiellen Unterschied zwischen den der stofflichen Welt von den Wissenschaftlern zugeschriebenen Quantitäten und den den Stoffen als Gegebenheiten inhärenten Qualitäten. In diesem Unterschied zwischen den Quantitäten und Qualitäten der Stoffe liegt auch der Unterschied zwischen Physik und Chemie.
Im Zeitraum dieser zweihundertjährigen Phasenverschiebung zwischen der Physik als Wissenschaft und der Chemie als Wissenschaft wurde in der Bemühung um die Erfassung der stofflichen Qualitäten mit angepasst zugeordneten Quantitäten aus der Alchimie die Chemie. Am Ende dieses Weges steht LAVOISIER mit einem Messinstrument in Händen, das die Masse als eine Quantität der Stoffe zu messen vermag: die Waage. Doch ist der prinzipielle Unterschied zwischen den Quantitäten und Qualitäten der Stoffe geblieben. Qualitäten können als Gegebenheiten der Natur mit den von uns hervorgebrachten Quantitäten nicht erfasst werden. Aus diesem Grunde wird jener Teil der Chemie, der die Qualitäten der stofflichen Welt umfasst, dem Wesen nach immer Alchimie bleiben. Diese Feststellung ist nicht etwa als eine Abwertung der Chemie als Wissenschaft aufzufassen. Im Gegenteil! Das alchimistische Moment der Chemie besteht in der schauenden, morphologischen Betrachtung der Stoffe, die dem Chemiker denjenigen Teil der stofflichen Welt der Gestaltung zugänglich macht, der mit dem Begriff «chemische Eigenschaften» belegt wird. Im Gegensatz zu den quantitativ beschreibbaren «physikalischen Eigenschaften» erfassen die «chemischen Eigenschaften» das sogenannte «Innere» der Stoffe. Aus diesem Grunde werden die «chemischen Eigenschaften» - oftmal mit einer gewissen Verlegenheit - «innere Eigenschaften» der Stoffe genannt. Diese Verlegenheit ist ernst zu nehmen, denn sie hängt damit zusammen, dass die eigentlichen «chemischen Eigenschaften», eben die «inneren Eigenschaften» der Stoffe, mit Quantitäten nicht erfasst werden können. Auch ist diese Verlegenheit ein weiteres Merkmal, um welches sich die Physik von der Chemie unterscheidet.
Es ist kein Verdienst der Physiker, dass sich ihre Wissenschaft nicht in einer Verlegenheit solcher Art befindet. Die Physik hat andere, gewissermassen selbstgemachte Verlegenheiten vorzuweisen. Zum Beispiel die Komplementaritätsphänomene, über die ein Physiker wohl kaum glücklich ist. Die Physik hat sich nicht zur Aufgabe gestellt, mit den von der Natur gegebenen Qualitäten der Stoffe zu experimentieren. Vielmehr wendet sie selbstgeschaffene Quantitäten auf die Gegebenheiten der Natur an. Bei dieser Anwendung des Selbsthervorgebrachten kommt die Physik nie in Verlegenheit, da sie die Mannigfaltigkeit der stofflichen Gegebenheiten entweder abstrahiert oder ihre Experimente so ansetzt, dass sie von den individuellen Qualitäten der Stoffe unabhängig durchgeführt werden können. So ist es dem Physiker beispielsweise gleichgültig, was die chemischen Eigenschaften der Gläser sind, mit welchen er seine optischen Instrumente baut. Der Chemiker aber steht unmittelbar vor der Frage «Was ist Glas?» GALILEI hat durch sein Fernrohr die Jupitermonde beobachtet, längst bevor sich die Chemiker diese Frage stellten.
Die quantitativen Fragenstellungen der Chemie können immer auf physikalische Prinzipien zurückgeführt werden. Die Quantitäten sind aber nicht das Wesen der Chemie. Die von der Natur gegebenen Qualitäten stehen als Gestalthaftigkeiten immer innerhalb der von uns hervorgebrachten Quantitäten. Das heisst, die Quantitäten erscheinen als Gefässe, mit welchen wir aus dem Brunnen der chemischen Substanzen schöpfen. In diesem Sinne handelt es sich bei den chemischen Eigenschaften tatsächlich um die «inneren» Eigenschaften der Stoffe. Diese «Innerlichkeit» der Stoffe vermag derjenige Teil der modernen Chemie, der auf den Quantitäten der Physik fundiert, nicht zu fassen. Als einziger Weg bleibt, wie bei allen Gegebenheiten der Natur, die schauende Betrachtungsweise der Morphologie offen, die unter anderem im sogenannten Substanzgefühl des Chemikers zum Ausdruck kommt. Dieser Teil der Chemie ist Alchimie geblieben und wird es bleiben. Es ist zu beachten, dass dies ein wesentlicher Teil der Chemie ist. Jene Alchimie, die, wissenschaftlich betrieben, zur Chemie als Wissenschaft, zur modernen Chemie führte. Es ist ein Zeichen des mechanistisch-deterministischen Zeitalters, dass sich die Menschen oft ihrer Gefühle schämen. Es ist auch ein Zeichen dieses Zeitalters, dass das auf dem Hervorbringen von Dingen beruhende differentiell-kausale Prinzip gegenüber dem schauenden Erkennen der Morphologie überbewertet wird. Die Chemiker brauchen sich ihres Substanzgefühls nicht zu schämen. Es soll daran erinnert sein, dass sowohl die moderne Atomtheorie als auch die Kernspaltung mit typisch chemischen Methoden gegründet wurden. Die Atomtheorie ging aus den Gesetzen der konstanten und multiplen Proportionen von JOHN DALTON und dem Gasvolumengesetz von AMADEO AVOGADRO hervor. Die Spaltung des Urankerns wurde mit chemischen Analysen, die für diesen Fall ein ganz besonders in die Tiefe gehendes chemisches Substanzgefühl erforderten, von den Chemikern OTTO HAHN und FRITZ STRASSMANN gefunden. So kam es, dass für eine physikalische Entdeckung von allergrösster Tragweite ein Nobelpreis für Chemie verliehen wurde.
Die moderne Chemie kann als eine Summe aus quantitativen Stoffbeziehungen und morphologischen Stoffbetrachtungen aufgefasst werden. Da das Wesen der Stoffe als Gegebenheit der Natur nur schauend-morphologisch und nicht hervorbringendquantitativ zugänglich ist, wird die Wissenschaft von den Stoffen und den stofflichen Veränderungen immer die vom alchimistischen Stoffgefühl des Menschen getragene Chemie bleiben. In diesem Substanzgefühl wurzelt das chemische Denken, das durch die Quantitäten einer physikalischen Betrachtungsweise nicht zu ersetzen ist.
Das differentiell-kausale Prinzip
Die Mannigfaltigkeit der Welt, in der wir leben, offenbart sich unseren Sinnen in einer strahlenden, aber auch verwirrenden Fülle von werdenden, seienden und vergehenden Gestalten. Solange wir die Natur mit unserem eigenen Ganzsein als Ganzes betrachten, bedeutet diese Mannigfaltigkeit eine Welt, die sich zu einer geschlossenen Ganzheit vereinigt, in der wir leben und erleben können. Die Menschen des klassischen Altertums lebten in der bergenden und aufnehmenden Geschlossenheit eines ganzheitlichen Weltbildes. Der Geist war ihnen nicht Widersacher der Seele, da sie ihre Innerlichkeit weder in sich noch von deren Gefäss, dem Körper, spalteten. Seele, Geist und Körper waren in der Antike eine in der Mannigfaltigkeit eines geschlossenen Weltbildes unteilbare Ganzheit. Diese Tatsache lässt die historische Eigenartigkeit des so späten Auftretens der exakt-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise in einem Licht von besonderem Aspekt erscheinen.
Sobald der Geist sich von der Seele trennt, erblicken unsere Sinne die Mannigfaltigkeit der Natur im Spiegel der Ratio. In diesem werden die Lichter der Welt als verwirrende Fülle reflektiert. Dem Verstand fehlt die vereinigende Kraft der Seele. Er vermag die Mannigfaltigkeit der Welt nicht als Ganzheit zu erfassen. Die exakten Naturwissenschaften aber fordern eine ausschliesslich rationale Betrachtungsweise der Welt. Der Geist wird daher gezwungen, sich von der Ganzheit des menschlichen Seins abzutrennen und davon losgelöst die Natur zu betrachten. Er wird dabei zu dem, das wir heute als Intellekt bezeichnen. Ausserstande, die Mannigfaltigkeit als Ganzheit zu erfassen, sieht sich der Intellekt gezwungen, die Welt in für ihn fassbare Einzelteile aufzulösen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das rationale Fassungsvermögen um so grösser wird, je kleiner der ins Auge gefasste Bereich ist. Das hat dazu geführt, dass die Bereiche, in welchen sich die exakt-naturwissenschaftliche Betrachtungsweise und Tätigkeit abspielen, immer kleiner und kleiner werden. Diese Tatsache ist beachtlich. So musste beispielsweise die Materie in Moleküle, die Moleküle in Atome und die Atome in noch kleinere Elementarteilchen aufgespalten werden. Dass die Materie mit Experimenten, die Atome fordern, mit Atomen zu antworten vermag, ist bei der Mannigfaltigkeit der Materie nicht erstaunlich. Die Atombombe ist kein Beweis für die Atome als Ding an sich. Denn die Atome der Atombombenerfindungszeit sind von den Atomen von heute sehr verschieden. Das heisst, das Atommodell hat sich verändert. ERNEST RUTHERFORD und NIELS BOHR würden staunen. Etwas anderes als ein Modell ist das Atom eben nicht. Es ist eine gedachte Maschine. Für das Rezept zur Herstellung der Bombe waren die damaligen Modelle so gut wie das heutige. Der bedeutende Physiker ERNST MACH, den ALBERT EINSTEIN zu den Wegbereitern der Relativitätstheorie gezählt hat und dessen Name heute durch die Überschallfliegerei populär ist, hat gewagt, an der Realität der Atome zu zweifeln. Es sollte über den Erfolgen der Atomphysik nicht vergessen werden, dass die Materie in ihrer Mannigfaltigkeit nicht nur Atome zu geben vermag.
Da das quantitative Moment ein wesentlicher Teil der exakt-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise darstellt, wurde im Reichtum des mathematischen Denkens nach einem Kalkül gesucht, das die von der Ratio geforderten kleinsten Bereiche der Natur quantitativ zu beschreiben vermag. Der Deutsche GOTTFRIED LEIBNIZ und der Engländer ISAAC NEWTON haben es unabhängig voneinander im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts gefunden. Das Differentialkalkül. Von den Brüdern JAKOB und JOHANN BERNOULLI wurde die Differentialrechnung in Hinsicht auf die Bearbeitung von physikalischen Fragestellungen weiter ausgebildet.
Die Differentialrechnung kann als ein wesentlicher Teil des differentiell-kausalen Prinzips angesehen werden. Die exakten Naturwissenschaften sind daher vom Wesen der Differentialrechnung durchdrungen. Die auf der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise beruhenden Gesetze der Physik haben alle einen differentiellen Charakter. Wie der Name zum Ausdruck bringt, beruht das Charakteristische dieser sowohl für die reine Mathematik als auch Naturwissenschaften und Technik so bedeutungsvollen Denk- und Rechnungsart auf der Betrachtung von Unterschieden und Änderungen. Das Besondere, das diese relativierende Rechnungsmethode so erfolgreich machte, besteht in der Möglichkeit, die ins Auge gefassten Unterschiede und Änderungen beliebig klein zu machen. Werden nämlich mit unendlich kleinen Differenzen Quotienten gebildet, so weisen diese Differentialquotienten endliche Werte auf, mit welchen nach den Regeln der Infinitesimalrechnung operiert werden kann. Diese mathematische Möglichkeit, zu deren Auffindung es der Genies LEIBNIZ und NEWTON bedurfte, kommt einer Schwäche unseres Intellekts helfend entgegen. Der Schwäche nämlich, dass es dem Intellekt nicht möglich ist, die Mannigfaltigkeit der Welt als Ganzheit zu fassen. Das Ganze entgleitet dem Intellekt. Es ist dem Menschen nur in Beziehung zu sich selbst und mit dem Mass seiner selbst zugänglich. Je mehr wir die Ganzheit der Welt schauen wollen, um so mehr werden wir gezwungen, die exakten Naturwissenschaften zu verlassen und uns der schauenden Betrachtungsweise der Morphologie zuzuwenden. Beschreiten wir den Weg zur Ganzheit weiter, so führt er in das Reich der Philosophie und Künste. Der Intellekt versinkt in der Seele. In diesem Zustand wird ihm seine Schwäche offenbar.
Das Differentialkalkül verheisst eine Überwindung dieser Ohnmacht. Denn mii seiner Hilfe lässt sich die Gesamtheit der Welt in beliebig kleine, berechenbare Elemente zerlegt denken. Ich betone: denken. Ob sich die Welt in Wirklichkeit in Differentiale zerlegen lässt, ist eine andere Frage. Doch die Verheissung der Differentialrechnung ist mehr als nur Zerlegung in rational erfassbare Elemente. Denn die nach dieser quantitativen Methode gewonnenen Elemente, die Differentiale, tragen eine Information, die es erlaubt, mit den Mitteln der Infinitesimalrechnung eine Integration durchzuführen. Es werden dabei Integrale gewonnen, die ein ausgedehntes Ganzes darstellen. Dem Intellekt scheint es dadurch gelungen zu sein, das, was die Seele schauend erfühlt, nämlich die Ganzheit der Welt, rational erfasst zu haben. Dieses Vorgehen ist tatsächlich beeindruckend. Denn aus unendlich kleinen, durch ein Kalkül rational erfassbaren Elementen wurde durch Integration eine Ganzheit geschaffen, die dem Intellekt zugänglich ist. Das Rezept dafür würde etwa folgendermassen lauten: Man zerlege die Welt mit der Methode des differentiell-kausalen Prinzips in infinitesimale Elemente. Diese sind, im Gegensatz zur Gesamtheit, der Ratio zugänglich. Durch Integration wird die Gesamtheit wieder hergestellt, die jetzt, nachdem sie die differentiell-kausale Analyse durchlaufen hat, rational erfassbar geworden ist.
Im Gegensatz zur mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise ist das differentiell-kausale Prinzip in den meisten Fällen nicht vorstellbar. Doch erhebt die Ratio der Physik keinen Anspruch auf Gestalt und Farbe als hinreichende und notwendige Bedingungen. Somit wird dieser Umstand von den Physikern nicht als Mangel empfunden.
Von dieser Seite wird die differentiell-kausale Methode meistens beleuchtet. Doch um ein vollständiges Bild zu erhalten, bedarf es noch des Lichts aus anderer Richtung. Wie schon gesagt, ist das differentiell-kausale Prinzip nur auf mechanistisch-deterministische Systeme anwendbar. Bei solchen Systemen handelt es sich aber immer um Maschinen. Strenggenommen um gedachte Maschinen, die durch Abstraktion der Wirklichkeit erhalten wurden. Die Differentiale haben also einerseits die Gedanken dieser Abstraktion impliziert und tragen andererseits die von den Regeln der Infinitesimalrechnung herrührende Prägung. Es ist daher leicht einzusehen, dass eine solche Integration lediglich wieder ein mechanistisch-deterministisches System liefern kann, das immer eine Abstraktion der Wirklichkeit darstellt. Was durch die differentiellkausale Behandlung eines mechanistischen Systems gewonnen wurde, sind quantitative Aussagen über die diesem System zugrunde gelegte Maschine. Im Bereiche der Maschinen ist dies, wie die technischen Erfolge zeigen, von weitragender Bedeutung. Mit der Kanone kann nicht nur geschossen, sondern auch getroffen werden. Doch nicht nur in den Händen der Techniker ist das differentiell-kausale Prinzip ein mächtiges Werkzeug. Vielmehr waren es die exakten Naturwissenschaften, aus welchen die Technik ja ihre Substanz bezieht, die sich dieser Methode seit bald drei Jahrhunderten und heute mehr denn je bedienen. Das Epitheton «exakt» bezieht sich auf die Berechenbarkeit. Zweifellos muss der Physik der Anspruch zugestanden werden, die exakteste aller Naturwissenschaften zu sein. Durch die mechanistisch-deterministischen Abstraktionen der Physik und deren differentiell-kausale Behandlung wurden Gesetzmässigkeiten gefunden, die sich für gewisse Teile der Welt als gültig erwiesen. Es sind das diejenigen Zustände und Abläufe in der Welt, welche die dem Phänomen Leben typischen Eigenschaften nicht enthalten. Diese Materie hat - im Gegensatz zum Leben - die Eigenschaft, dass sie sich durch Aufpressen der mechanistisch-deterministischen Matrix in einen Zustand bringen lässt, der einer differentiell-kausalen Behandlung zugänglich ist.
Für die Lebensformen kann kein Differential gefunden werden. Sie sind daher nicht von einem kleinen, rational erfassbaren Bereich ausgehend integrierbar, wie dies z.B. mit der raum-zeitlichen Gestalt eines elektromagnetischen Feldes möglich ist. Das Leben ist mehr als eine Summe von Nichtlebendigem. Es gibt kein Lebensdifferential, das sich unter Anwendung des differentiell-kausalen Prinzips der exakten Naturwissenschaften zur Ganzheit der Lebensformen integrieren lässt. Dessen sollte sich die molekulare Biologie bewusst sein. Das Leben besteht aus mehr als dem Baumaterial, das sich in Moleküle und Atome auflösen lässt.
Zum Bau einer Maschine bedarf es des Baumaterials, eines Bauplans und eines Baumeisters. Der Bauplan wird vom Menschen gemacht, und der Baumeister ist der Mensch. Auch zum Werden, Sein und Vergehen eines Lebewesens bedarf es des Baumaterials, eines Bauplans und eines Baumeisters. Jedoch sind hier alle drei, im Gegensatz zur Maschine, im Lebewesen selbst enthalten und vereinigt. Darin besteht der Unterschied zwischen einem Lebewesen und einer Maschine.
Mit der exakt-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise können nur gedachte oder wirkliche Maschinen erfasst werden. Es wäre ein grosser Irrtum, zu glauben, die lebende Zelle sei im Sinne des differentiell-kausalen Prinzips ein Differential des Lebens. Für die Gesetze der Physik ist eine Amöbe genau so unfassbar wie ein Elefant. Oder mit anderen Worten, das Phänomen Leben kann der Ratio nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Bereich des Lebendigen kleiner und kleiner gemacht wird. Das Leben erscheint immer in Ganzheiten. Das ist der Grund warum ein Lebensdifferential allen Anstrengungen zum Trotz nicht gefunden werden konnte. ERWIN CHARGAFF sagt: «Das Leben ist dasjenige, das im Reagenzglas verschwindet.»
 Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved
Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved
Webmaster by best4web.ch